#
Physik
Nietzsche und die Philosophie der Orientierung
Im Gespräch mit Werner Stegmaier
Nietzsche und die Philosophie der Orientierung
Im Gespräch mit Werner Stegmaier
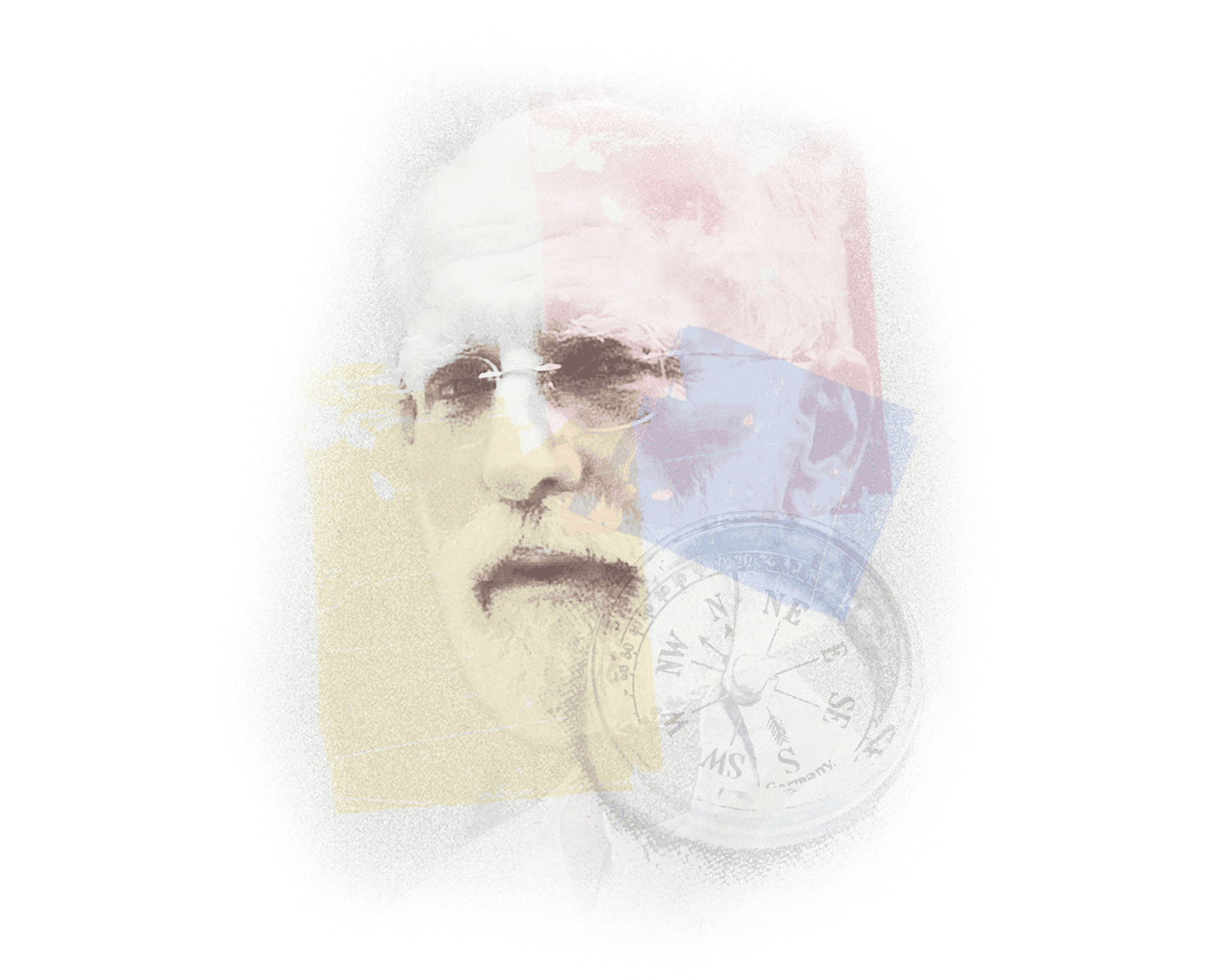
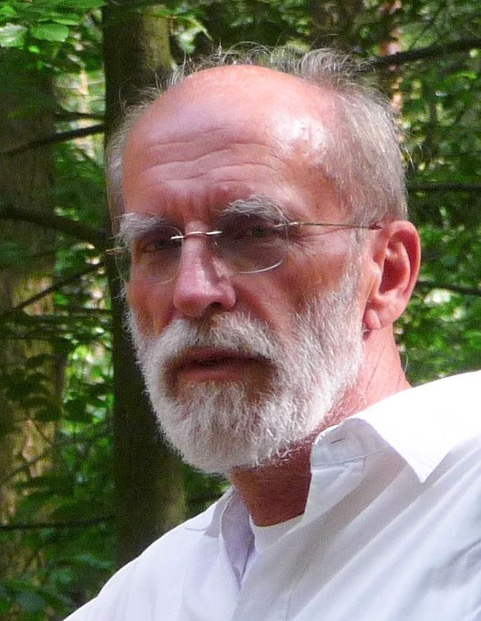
Anlässlich des 125. Todestags von Nietzsche am 25. August unterhielten wir uns mit zwei der international anerkanntesten Nietzsche-Experten, Andreas Urs Sommer und Werner Stegmaier. Während sich das Gespräch mit Sommer (Link) vor allem um Nietzsches Leben drehte, sprachen wir mit letzterem über sein Denken, dessen Aktualität und Stegmaiers eigene „Philosophie der Orientierung“. Was sind Nietzsches zentrale Einsichten? Und inwiefern helfen sie uns dabei, uns in der Gegenwart zurechtzufinden? Was bedeutet sein Konzept des „Nihilismus“? Und was sind die politischen Implikationen seiner Philosophie?
Seht, ich lehre euch den Transhumanisten
Friedrich Nietzsche als Personal Trainer des Extropianismus
Seht, ich lehre euch den Transhumanisten
Friedrich Nietzsche als Personal Trainer des Extropianismus


Nachdem Natalie Schulte in der vergangenen Woche über den Widerhall von Nietzsches „Übermenschen“-Idee in der Gründerszene berichtete (Link), widmet sich der Schweizer Kunstwissenschaftler Jörg Scheller in dieser Woche ihrem Fortleben im Extropianismus, einer Unterform des Transhumanismus, der es darum geht, die menschliche Evolution auf individueller wie auch auf Gattungsebene künstlich zu beschleunigen mit den Mitteln der modernen Technik. Dem physikalischen Gesetz der „Entropie“, wonach in geschlossenen Systemen die Tendenz besteht, alle Energiegefälle auszugleichen, bis sich ein Gleichgewichtszustand hergestellt hat – auf das Universum bezogen ein Zustand des völligen Erkaltens –, setzen die Verfechter dieser Strömung das Prinzip der „Extropie“, der zunehmenden Vitalität eines Systems, entgegen.
Aufklärungsdämmerung
Nietzsches Wahrheit des Scheins II
Aufklärungsdämmerung
Nietzsches Wahrheit des Scheins II


Nachdem Michael Meyer-Albert im ersten Teil seines Textes die, traurige, Geschichte von den Selbstzweifeln der Aufklärung erzählte, berichtet er nun von Nietzsches „fröhlicher Wissenschaft“ als Gegenentwurf.