Die Barbaren des 21. Jahrhunderts
Narzissmus, Apokalypse und die Abwesenheit des Anderen
Die Barbaren des 21. Jahrhunderts
Narzissmus, Apokalypse und die Abwesenheit des Anderen


Die Diagnose unserer Zeit: keine heroischen Barbaren, sondern Selfie-Krieger. Dieser Essay, den wir mit dem zweiten Platz des diesjährigen Eisvogel-Preises (Link) auszeichneten, spürt Nietzsches Vision der „stärkere[n] Art“1 nach und zeigt, wie sie in einer narzisstisch geprägten Kultur in ihr Gegenteil verkehrt wird – Apokalypse als Pose, der Andere als blinder Fleck. Doch anstelle des großen Bruchs eröffnet sich eine andere Möglichkeit: eine „barbarische Ethik“ der Verweigerung, der Ambivalenz, der Beziehung. Wer sind die wahren Barbaren des 21. Jahrhunderts – und brauchen wir sie überhaupt?
I. Der Barbar als Denkfigur zwischen Kritik und Projektion
Der Begriff des „Barbaren“ ist in der Kultur- und Ideengeschichte eine semantische Scharnierfigur zwischen Abgrenzung und Erwartung, zwischen Identitätsstiftung und transgressivem Wunschdenken. Nietzsche verleiht dem Begriff in seinen späteren Schriften eine zukunftsgerichtete Funktion: Die kommenden Barbaren sollen nicht nur Zerstörer sein, sondern auch Träger einer neuen Stärke, einer regenerativen Kulturmacht. Doch was meint diese Vision, wie lässt sie sich angesichts aktueller gesellschaftlicher, politischer und psychologischer Phänomene wie Populismus, Selbstdarstellungskultur und antiintellektuellen Bewegungen deuten?
Nietzsches oft als prophetisch empfundene Rhetorik birgt eine problematische Tendenz: Die Sehnsucht nach „Überwindung“ der Gegenwart kann selbst Ausdruck von Ohnmacht und mangelnder Adaptationsfähigkeit sein. Das Denken des radikalen Bruchs ersetzt dann die konkrete Kritik und Handlungsmächtigkeit durch eine ästhetisierte Apokalypse. Dies gilt es kritisch zu analysieren.
Der Begriff bárbaros stammt etymologisch aus dem Altgriechischen: „Bar-bar“ imitierte die Sprache der Nicht-Griechen. Der Barbar war somit der sprachlich Fremde, der außerhalb der kulturellen Ordnung stand. Aus dieser sprachlichen Differenz entwickelte sich sukzessive eine moralische und zivilisatorische Wertung: Der Barbar wurde zum Unzivilisierten, zum Bedrohlichen, zum Gegenbild des „Wir“.
In dieser historischen Semantik liegt der Ursprung einer Struktur kollektiver Identitätsbildung durch Abgrenzung. Der Barbar dient als Negativfolie, durch die sich ein kulturelles „Wir“, eine Gruppenidentität, konstituieren kann. Diese Dichotomie zwischen Eigenem und Fremdem, Innen und Außen, zeigt sich bis heute in politischen Diskursen, etwa in nationalistischen, antiintellektuellen und populistischen Bewegungen. Wie Giorgio Agamben und Achille Mbembe bereits analysierten, ist die Figur des Barbaren eine biopolitische Markierung, die Ausschluss organisiert, Gewalt legitimiert und den Ausnahmezustand zum Normalfall macht.2
II. Nietzsche und die Ambivalenz des Barbarischen
Nietzsche stellt den Begriff des Barbaren in einen anderen Zusammenhang. Für ihn ist der Barbar nicht primär der Unterentwickelte, sondern der Ungebrochene. V. a. im Nachlass und in der Genealogie erscheint der Barbar als Träger eines rohen, ungezügelten Willens zur Macht, der der modernen Gesellschaft – durch Moralisierung, Ressentiment und Schwäche – abhandengekommen ist.3 Wer mag da nicht an gegenwärtige Präsidenten und Despoten, aber auch die zelebrierte Selbstdarstellung der eigenen Besonderheit auf Social-Media-Plattformen denken? Diese Barbaren des 21. Jahrhunderts erscheinen einigen von uns als Leitbilder, als Hoffnungsträger – anderen jedoch als Menetekel. Dabei entsteht, gleich, welchem Lager man sich zuordnet, stets eine Dialektik der Abgrenzung.
Doch die Sehnsucht nach einem kulturellen Bruch, nach einer „stärkeren Art“, wird nicht von einer konkreten Theorie der Transformation getragen. Vielmehr flüchtet sie sich (wie bereits Nietzsche) in das Imaginäre des Bruchs, das a priori die tatsächliche politische und kulturelle Arbeit substituiert. Die „Barbaren“ erscheinen als Heilsbringer ex negativo: Ihre Größe ist nicht gestaltet, sondern erhofft. Diese Philosophie der Hoffnung durch Verwerfung ist letztlich ein Zeichen philosophischer Hilflosigkeit, ein apokalyptisches Sich-Sehnen nach dem Anderen. Doch die verwirklichte Dystopie der modernen Barbarei – sichtbar in der Narzisstifizierung der Gesellschaft, in politischen Drohgebärden und im Krieg – ist weder strategisch geplant noch kalkuliert oder erwartet: Sie bricht vielmehr als unvorhersehbare Realität über uns herein, erwächst aus komplexen Dynamiken gesellschaftlicher Entwicklung und eskaliert in Gestalten, die weder politisch noch kulturell in ihrer Tragweite vorausgesehen werden konnten.
III. Die neuen „Barbaren“: Populismus, Narzissmus und Querdenkertum
In der Gegenwart begegnen uns identitätskreierende Zusammenschlüsse, die sich selbst als barbarisch – im Sinne Nietzsches – inszenieren. Die Querdenkerbewegung, Konspiratisten-Gruppierungen oder auch die an ein Helden-Epos glaubende Anhängerschaft eines Trump, Putin und anderer autoritär-populistischer Strömungen stilisieren sich als Widerstand gegen Dekadenz, Eliten, Moderne. Doch sie bleiben in der Logik des Ressentiments gefangen. Was sie kritisieren, ist oft weniger das System, als vielmehr ihre eigene Marginalisierung darin.
Die postmoderne Gesellschaft ist über den Sinnverlust hinaus zunehmend von einer narzisstischen Selbstverliebtheit, die jede Alterität zum Verschwinden bringt, bedroht. Es scheint, als sei die radikale „Barbarei“, die Nietzsche sich erhoffte, nicht eingetreten – stattdessen hat sich eine weichgespülte, performative Variante des Barbaren durchgesetzt: der narzisstische Konsument, der alles Andere seinem Selbstverwirklichungspathos unterordnet.
Nietzsche diagnostizierte eine Kultur, in der die großen Erzählungen versiegen und die transzendentalen Fundamente einstürzen. Er erwartete als Antwort darauf nicht einen Rückzug, sondern eine neue Art Mensch, die sich nicht an Werten orientiert, sondern Werte setzt. Heute sehen wir das Gegenteil: Die spätmoderne Gesellschaft ist von einem Willen zum Image durchzogen. Es geht nicht mehr um das Sein, sondern um das Sichtbarsein. Der Mensch stilisiert sich selbst zur Marke, die nur funktioniert, solange sie Begehrlichkeit erzeugt.
Hier wird Nietzsches Konzept der Selbstüberwindung pervertiert: Nicht mehr das Werden, das Wachstum, das Risiko steht im Vordergrund, sondern eine narzisstische Selbstaffirmation, die alles Andere – im Sinne Byung-Chul Hans – verdrängt. In Die Austreibung des Anderen beschreibt Han eine Gesellschaft, die das Fremde, das Unverfügbare, das Irritierende systematisch ausschließt, um ein narzisstisch gespiegeltes Selbst aufrechtzuerhalten. In dieser Welt ist der Andere nicht mehr eine Herausforderung oder eine Chance zur Entwicklung, sondern ein Funktionsobjekt: bewertet, benutzt, beseitigt.
Der neue Barbar ist kein Krieger mehr. Er tritt als Kurator seiner eigenen Sichtbarkeit auf. Seine Waffen sind Filter, Hashtags und Algorithmen. Diese Barbarei ist still, glatt, affirmativ – und genau darin radikal. Es ist die Barbarei der Optimierung, in der der Andere statt zerstört zu werden eher in Bedeutungslosigkeit verschwindet. Beziehungen werden zum Projekt, Menschen zu Ressourcen, Intimität zur Ware.
Han spricht hier von der neoliberalen Vernutzung des Anderen. Der Andere erscheint nicht mehr als radikale Differenz, als Widerständigkeit, sondern wird durch ein Netz der Kontrolle, der Bewertung, der Vergleichbarkeit in eine ökonomische Struktur überführt. Der neue Narzissmus ist nicht (nur) pathologisch – er ist systemisch.
Nietzsche beklagte eine „Verweichlichung“4 des Menschen. Heute haben wir es mit einer Verflüssigung zu tun: Nichts bleibt, alles fließt, alles muss performen. Die Barbaren des 21. Jahrhunderts kommen nicht mit dem Schwert: Sie halten den Selfie-Stick hoch. Sie zerstören nicht Gebäude, sondern Bedeutungsräume.
IV. Die narzisstische Kultur als nihilistische Fortsetzung
Man könnte versucht sein, diese narzisstische Kultur als das genaue Gegenteil von Nietzsches Barbaren zu deuten. Doch sie ist vielmehr eine Konsequenz des von ihm beschriebenen Nihilismus: Wenn keine übergeordneten Werte mehr existieren, wird das Ich zum alleinigen Maßstab. Doch was wie eine Befreiung aussieht, ist in Wahrheit eine neue Form der Versklavung – eine Gefangenschaft im Eigenen.
Nietzsches Vision einer großen Gesundheit, einer affirmativen Existenz, setzt den Anderen voraus: als Widerstand, als Grenze, als Dialogpartner. Die narzisstische Kultur hingegen kennt nur das Echo. In der narzisstischen Dynamik wird das Andere nicht integriert oder überboten – das Andere wird so auf seine Spiegelfunktion reduziert, dass es eliminiert wird. So ist die gegenwärtige Barbarei eine Barbarei der Beziehungslosigkeit.
Die narzisstische Gesellschaft steht nicht nur in der Tradition der Aufklärung, sondern auch in derjenigen deren ihres paradoxen Zerfalls. Die Emanzipation des Subjekts hat in eine Isolation geführt. Soziale Netzwerke suggerieren Verbindung, erzeugen aber Vereinzelung. Der Andere wird zum Screen – seine Tiefe verschwindet. Nähe wird simuliert, während echte Begegnung unmöglich wird, die ständige Sichtbarkeit ersetzt die Subjektivität. Der Mensch wird zum Objekt seiner eigenen Überwachung. Der narzisstische Blick nach innen ist keine Selbstreflexion mehr, sondern ein permanentes Scannen nach Anschlussfähigkeit und Anerkennung.
Diese Bewegungen schaffen keine neue Kultur. Sie rufen nicht zur Selbstüberwindung, sie rufen zur Projektion. Ihre Revolte ist keine schöpferische Tat, sie ist Ausdruck von Unfähigkeit zur Gestaltung. Selbstermächtigung wird ersetzt durch eine performative Opferhaltung, die allzu leicht mit Aggression und Gewaltbereitschaft kompensiert wird.
Auch im narzisstischen Selbstinszenierungskomplex der „Selfie-Kultur“ zeigt sich eine scheinbare Subjektivierung, die aber vielmehr Ausdruck einer systemischen Ohnmacht scheint. Die „Marke Ich“ wird zur Kompensationsstrategie in einer entgrenzten Welt. Diese Form des digitalen Barbarentums ist jedoch nicht stark, sondern schal – eine Farce der Authentizität.
Nietzsche kritisiert die Schwäche der Moderne, verabsolutiert aber zugleich eine unkonkrete Hoffnung auf einen Bruch. Diese Dialektik mündet in ein paradoxes Verhältnis: Der Ruf nach der „stärkeren Art“ ist Ausdruck der Erfahrung, selbst nicht gestalten zu können. Die Philosophie des Übermenschen gerät so zur Philosophie der Selbstentmächtigung, die ihre eigene Wirksamkeit nur noch durch ihren Gegensatz denken kann. Diese freiwillige Aufgabe der Handlungskompetenz kann in depressives Erstarren, in eine passiv-aggressive Verweigerungshaltung dem Fremden gegenüber münden, während gleichzeitig das „Andere“, das Identifikation erlaubende, Fremde, in Errettungsphantasien idealisiert wird.
Statt im Modus konkreter Praxis verharrt auch der zeitgenössische Barbarenbeschwörer in einer Ästhetik des Umsturzes. Die produktive Kraft der Philosophie wird durch eine Mythologie des Bruchs ersetzt. Walter Benjamin nannte dies die „linke Melancholie“: das Festhalten an revolutionären Gesten ohne revolutionäre Wirkung.5
Nietzsches Idee einer „stärkeren Art“ bleibt selbst in der Schwebe zwischen Überwindungsphantasien und resignativer Kulturkritik. In der Vorstellung, dass „nur die Barbaren uns retten können“, steckt eine Verweigerung der Adaptation: Die Gegenwart wird nicht als gestaltbar gedacht, sondern als dekadent, verfallen, dem Untergang geweiht.
Eine gegenwartsbezogene Philosophie muss jedoch zur Kritik und zur Gestaltung fähig sein. Der Blick auf das „Barbarische“ darf nicht zur mythologischen Figur verkommen, sondern muss als Spiegel dienen: Was fehlt uns, dass wir uns nach Zerstörung sehnen? Warum glauben wir, nur von außen könne die Kraft kommen, die wir in uns nicht mehr finden?
V. Die Möglichkeit einer neuen Barbarei: Transformation statt Transgression
Statt einer Rückkehr zur Gewalt oder zum symbolischen Individualismus, braucht es heute vielleicht eine radikale Rehabilitierung des Anderen. Der „Barbar“ der Gegenwart könnte nicht der sein, der zerstört, sondern jener, der sich der totalen Instrumentalisierung verweigert – der in seiner Existenz das Andere verkörpert: Unverfügbarkeit, Ambivalenz, Widerstand.
Eine neue Barbarei müsste die Systeme der Bewertung sprengen. Sie müsste dem narzisstischen Blick das Verstummen entgegensetzen. Vielleicht sind es die Schwachen, die Ambivalenten, die Unpassenden, die heute in der Lage wären, eine neue Form von Beziehung zu ermöglichen – nicht durch Macht, sondern durch Präsenz. Eine „barbarische Ethik“ wäre dann keine Ethik der Gewalt, sondern eine Ethik des Nicht-Funktionierens.
Die Figur des Barbaren verweist historisch auf Ausgrenzung, symbolische Gewalt – und zugleich auf die immer wiederkehrende Hoffnung auf Neuanfang. Nietzsche hat diese Figur philosophisch überhöht und sie zu einer Projektionsfläche für die Überwindung der Moderne gemacht. Doch in dieser Überhöhung liegt eine doppelte Gefahr: Die Erneuerung wird externalisiert – sie soll von außen kommen, in Gestalt des „anderen Menschen“. Und sie wird ästhetisiert – als heldenhafter Akt, als Pathos des Bruchs.
Gegen dieses Denken im Bruch plädiert eine Ethik der Transformation: Sie nimmt das Bestehende ernst, nicht weil es gut ist, sondern weil es real ist. Transformation beginnt nicht mit Gewalt. Sie beginnt mit Aufmerksamkeit. Sie ist ein leiser, langwieriger, konfliktreicher Prozess, der Irritationen zulässt und Ambivalenzen aushält. Im Gegensatz zur transgressiven Geste, die das Gesetz missachtet, sucht die Transformation nach anderen Regeln, nach anderen Formen des Umgangs mit Macht, Verletzlichkeit und Verantwortung.
Transformation bedeutet, den Anderen statt als Hindernis als Möglichkeit zu begreifen. Sie bedeutet, sich jenseits der Inszenierung als Marke als Beziehung zu denken. Und sie bedeutet, den Schmerz der Gegenwart nicht mit der Hoffnung auf eine utopische Zukunft zu betäuben: Aus dem Schmerz heraus ist die Arbeit der Veränderung zu beginnen. Sie ist nicht weniger radikal als der Umsturz – aber sie ist langsamer, tiefer, und nachhaltiger.
Was wir heute brauchen, sind keine Barbaren, sondern Transformatoren: Menschen, die bereit sind, mit den Ruinen der Moderne weiterzubauen – ohne Zynismus, ohne Heilsversprechen, mit einem Sinn für das Mögliche im Wirklichen. Das erfordert nicht heroischen Bruch, sondern radikale Geduld, nicht Apokalypse, sondern kulturelle Arbeit. Die eigentliche Stärke liegt eben nicht in der Inbrunst des Umsturzes, sondern in der Fähigkeit zur Dauer – und in der Kunst, trotz allem nicht nur zu hoffen, sondern zu handeln.
Marion Friedrich, geboren 1973 in Deutschland, studierte in La Laguna (Spanien) Psychologie und anschließend in Augsburg (Deutschland) Philosophie. In ihrem Promotionsstudium an der Universität Augsburg beschäftigte sie sich insbesondere mit erkenntnistheoretischen Fragen der Neurophilosophie und der noetischen Anthropologie. Seit 2007 lehrt sie neben ihrer psychotherapeutischen Tätigkeit in ihrer eigenen humanistischen Praxis an der Universität Augsburg mit Schwerpunkten in Erkenntnistheorie, Sprachphilosophie, Emotionstheorien und Künstlicher Intelligenz. Ihre aktuellen Forschungsinteressen umfassen die Philosophie des Geistes, KI-Ethik und die Psychologie der Liebe. 2024 erschien von ihr der zusammen mit Joachim Rathmann und Uwe Voigt verfasste Band Ego oder Öko? Narzissmus und die ökologische Krise bei Reclam.
Quellen
Agamben, Giorgio: Homo Sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben. Frankfurt a. M. 2002.
Benjamin, Walter: Gesammelte Schriften III. Frankfurt a. M. 1991.
Han, Byung-Chul: Die Austreibung des Anderen. Gesellschaft, Wahrnehmung und Kommunikation heute. Frankfurt a. M. 2016.
Ders.: Psychopolitik. Neoliberalismus und die neuen Machttechniken. Frankfurt a. M. 2014.
Mbembe, Achille: Kritik der schwarzen Vernunft. Berlin 2017.
Das Artikelbild wurde von der Autorin mit Hilfe von ChatGPT erstellt.
Fußnoten
1: Nachgelassene Fragmente 1887 11[31].
2: Vgl. Agamben, Homo Sacer und Mbembe, Kritik der schwarzen Vernunft.
3: Vgl. u. a. Nachgelassene Fragmente 1885 34[112] und Zur Genealogie der Moral, Abs. I, 11 und I, 16.
4: Vgl. etwa Nachgelassene Fragmente 1887 10[2].

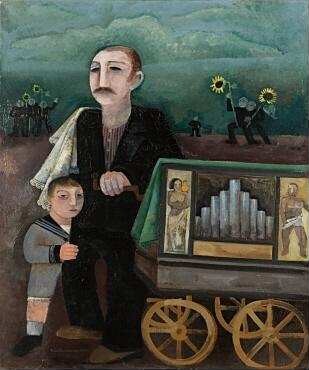
.jpg)






