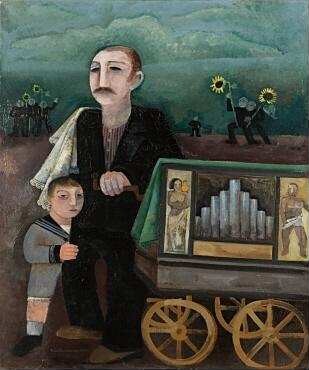Nietzsche und die intellektuelle Rechte
Ein Dialog mit Robert Hugo Ziegler
Nietzsche und die intellektuelle Rechte
Ein Dialog mit Robert Hugo Ziegler


Nietzsche wurde von rechten Theoretikern und Politikern immer wieder zur Galionsfigur erhoben. Von Mussolini und Hitler bis hin zur AfD – immer wieder wird Nietzsche in Beschlag genommen, wenn es darum geht, der modernen Gesellschaft eine radikale reaktionäre Alternative entgegenzustellen. Besonders faszinierte Nietzsche die intellektuelle Rechte, etwa Autoren wie Ernst Jünger, Carl Schmitt und Martin Heidegger, die in den 20er Jahren ein kulturelles Vorfeld des aufziehenden Nationalsozialismus bildeten, auch wenn sie sich später von ihm teilweise distanzierten. Oft spricht man auch von der „Konservativen Revolution“1.
Was entnehmen diese Autoren Nietzsche und inwiefern lesen sie ihn einseitig und übersehen andere Potentiale in seinem Werk? Unser Autor Paul Stephan sprach darüber mit dem Philosophen Robert Hugo Ziegler.
I. Mythenmacher
Paul Stephan: Sehr geehrter Herr Professor Ziegler, Sie haben im vergangenen Jahr die umfangreiche Studie Kritik des reaktionären Denkens publiziert, die erfreulicherweise auf der Verlagsseite kostenlos heruntergeladen werden kann (Link). Sie entwickeln dort nicht nur eine allgemeine Theorie reaktionären Denkens, sondern stellen auch einige seiner Klassiker vor. Neben „üblichen Verdächtigen“ wie Ernst Jünger (1895–1998), Carl Schmitt (1888–1985) oder Martin Heidegger (1889–1976) widmen Sie auch Nietzsche ein eigenes Kapitel. Das mag manche überraschen, andere weniger. Wie kommen Sie dazu, Nietzsche zu den Vertretern eines reaktionären Denkens zu rechnen?
Robert Ziegler: In der Tat würde ich Nietzsche nicht zu den reaktionären Autor*innen im engen Sinn rechnen. Nietzsche taucht in meiner Rekonstruktion als wichtiger Stichwortgeber und Vorbereiter für das reaktionäre Denken auf. Das lässt sich auf mehreren Ebenen nachweisen: Bekannt sind ja die zahlreichen und wortgewaltigen Invektiven, die Nietzsche gegen die Moderne, gegen Frauen, gegen alles, was nach Demokratie oder Egalitarismus riecht, gerichtet hat. Zum Theorieinventar späterer rechter Autoren gehört dann vor allem die Entgegensetzung der großen, starken Einzelnen und der schwachen, geistlosen Masse, die geführt werden muss und will – ein Motiv, dass von Nietzsche sehr regelmäßig bedient wird. Nietzsches radikaler Individualismus, der sich als Kampf gegen ganze Epochen und ihre Vorurteile versteht, lädt zu einer heroisierenden Selbstinszenierung ein, an der sich viele Spätere berauscht haben. Auch einzelne Themen wie die Nihilismus-Diagnose hatten und haben im rechten Denken Konjunktur.
Das alles ist recht offenkundig und bekannt. Folgenreicher scheint mir aber ein anderer Aspekt: Nietzsche kommt immer wieder, besonders konzentriert und prominent in Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne (Link), auf den Gedanken zu sprechen, dass, was wir Wahrheit nennen, das Produkt sprachlicher Interpretationen von Wirklichkeit ist. Damit hat Nietzsche einerseits eine zutiefst verunsichernde Diagnose gestellt, für die er andererseits einen möglichen Ausweg andeutet: Wenn alle Wahrheit ohnehin „Lüge“ oder Mythos ist, Produkt der Sprache mehr als unserer Erkenntnisbemühungen, noch dazu geleitet von vitalen Bedürfnissen – was hindert uns daran, die Bodenlosigkeit dieser Situation durch die Erfindung möglichst eindrücklicher und intensiver Mythen zu überwinden? Da ich die Reaktion primär als eine literarische Strategie begreife, die mit möglichst starken Mitteln einer ontologischen Unsicherheit zu begegnen sucht, lässt sich im Rückblick sagen, dass die Methode der Reaktion durch Nietzsches diesbezügliche Einlassungen geadelt wird.
PS: Man soll also aus dieser Sicht den Herausforderungen der Moderne durch die Kreation neuer Mythen begegnen? Faszination an die Stelle von Befreiung treten lassen? Oder genauer: In der Faszination eine Form der Pseudobefreiung von diesen Herausforderungen erleben? Diese Interpretation liegt aus meiner Sicht nahe, auch wenn sich Nietzsche oft als Aufklärer und „Mythenzerhämmerer“ inszeniert. Es scheint ihm ja eher darum zu gehen, die tradierten, unglaubwürdig gewordenen Mythen zu zerstören und an ihre Stelle neue treten zu lassen wie den „Willen zur Macht“, den „Übermenschen“ und die „ewige Wiederkunft“. Auch die progressiven Ideen der modernen Emanzipationsbewegungen stellen sich aus dieser Sicht als Mythen dar, allerdings „alte[] Weiber“2, keine lebensbejahenden. Was mich zu meiner nächsten Frage bringt: Ist die Kraft des Mythologischen denn notwendig eine reaktionäre Kraft? Hat Nietzsche nicht vielleicht sogar recht damit, dass auch die linken Bestrebungen ihre Energie aus bestimmten Mythen gewinnen? Sogar bei Friedrich Engels (1820–1895) etwa wird eine Parallele zwischen der Arbeiterbewegung und dem Urchristentum hergestellt3 und er interessiert sich – wie interessanterweise auch Nietzsche – sehr für den von Nietzsches Baseler Kollegen Johann Jakob Bachofen (1815–1887) entdeckten bzw., kritisch gesagt, erfundenen Mythos vom Urmatriarchat4. Und man könnte hier eine Unzahl weiterer Beispiele anführen.
RZ: Ich würde die Frage in zwei auseinanderlegen wollen. Zum einen bin ich in der Tat unsicher, ob es so etwas wie „linke Mythen“ geben kann. Es gibt, das ist wahr, immer die Versuchung, in Urzeiten und vor allem am erhofften Ende der Geschichte Gesellschaftsformen zu imaginieren, in denen die Gegensätze, Widersprüche und Kämpfe endlich zu einem Ende gekommen sind. Doch ob die Utopie den emanzipatorischen Bewegungen gutgetan hat, scheint mir nicht ausgemacht. Was die Geschichtsphilosophie angeht, halte ich die Warnungen Walter Benjamins (1892–1940) vor der Idee des Fortschritts für schwer zu ignorieren.
Zum anderen aber, um auf die reaktionären Denker zurückzukommen, hat die Literarisierung von Politik dort eine ganz charakteristische Gestalt: Sie ist erstens undurchschaut. Autoren wie Jünger oder Schmitt halten ihre Äußerungen gerade nicht für Konstrukte, Interpretationen oder neue Mythen, sondern im Gegenteil für die Zertrümmerung aller Illusionen und die Präsentation der nackten Wahrheit. Dass dieses theoretische Großreinemachen einen gewaltsamen Zug schon auf der Theorieebene hat, macht dabei offenkundig einen wichtigen Aspekt des Genusses aus. Zweitens nämlich kreisen reaktionäre Texte stets um die Motive von Kampf, Krieg, Feindschaft, Blut, Gewalt, Entscheidung, Tod. In der unablässigen (und oft ermüdenden) Evokation der Wirklichkeit als gnadenlosem Kampf versichert sich die Reaktion der übergeschichtlichen Wahrheit – einer Wahrheit, die entschieden antizivilisatorisch ist und primär durch die literarische Inszenierung Kraft gewinnt.
Was die Reaktion nun aus Nietzsche entnehmen konnte, wenn man ihn entsprechend las, war, dass man mit dem nötigen rhetorischen Nachdruck alles zur Wahrheit erheben konnte. Die Reaktion bedient sich also sowohl rhetorisch als auch motivisch – Nietzsche hatte bekanntlich ebenfalls eine Schwäche für bellizistische Terminologie, auch wenn sie oft metaphorisch verwendet wird – als auch methodisch bei Nietzsche.
Mein Zweifel daran, dass man aus linker Perspektive ungestraft Mythen stricken kann, lässt sich am Beispiel von Georges Sorel (1847–1922) verdeutlichen: Sorel stand politisch „eigentlich“ dem Syndikalismus nahe, ließ sich aber mehrfach von offen rechtsextremen Bewegungen und Organisationen faszinieren. Seine Überlegungen Über die Gewalt propagieren relativ offen die Strategie, mithilfe alter oder neuer Kampfesmythen Massenbewegungen zu mobilisieren. Hier ist die Strategie also klar ausgesprochen, und zugleich wird ihre Schwachstelle deutlich: Mythenbildung, Mobilisierung und gewaltsame Auseinandersetzung drohen zum eigentlichen Zweck zu werden. Inhalte sind dann relativ beliebig, eine konsistente linke Position lässt sich jedenfalls damit nicht durchhalten. Es überrascht dann wenig, dass sich Schmitt recht positiv auf Sorel bezieht.
PS: Ja, wie auch Mussolini (1883–1945), der ja auch ein großer Bewunderer Nietzsches gewesen ist.5 – Aber vielleicht gehen wir einen Schritt zurück an dieser Stelle. Eine große Stärke Ihrer Studie besteht ja darin, dass Sie den Begriff der „Reaktion“ philosophisch zu definieren und ihn so einer gewissen Beliebigkeit, mit der er bisweilen gebraucht wird, zu entreißen versuchen. Es wurden bisher einige wichtige Merkmale Ihres Begriffs des „reaktionären Denkens“ deutlich. Es handelt sich um die literarische Strategie der Konstruktion neuer Mythen – vor allem Mythen der Gewalt, des Krieges, vielleicht auch der Männlichkeit –, mit deren affektiver Kraft emanzipatorische Ideen untergraben und an ihrer Stelle neue „Wahrheiten“ etabliert werden sollen. Wobei es sich nicht um eine bewusste Strategie im Sinne einer zynischen Manipulation handelt. Ist das Ihres Erachtens bereits das Wesen reaktionären Denkens oder fehlt da noch ein wichtiges Element?
II. Die rote Pille
RZ: So wie ich reaktionäres Denken verstehe, reicht es nicht, seine Elemente zu verzeichnen. Vielmehr muss es als eine ganz spezifische Bewegung begriffen werden: Mir ist aufgefallen, dass die reaktionären Autor*innen immer wieder einen ontologischen Horror artikulieren. Sie ahnen oder wissen sogar, dass das Wirkliche vielleicht gar nicht im engen Sinn ist. Was sie umtreibt, ist die Möglichkeit einer umfassenden Unwirklichkeit. Das kann ganz philosophisch daherkommen, wie Heideggers „Uneigentlichkeit“, oder offen politisch, wie Schmitts Abfertigung des Parlamentarismus als einer leeren Form, die nur noch nicht mitbekommen hat, dass sie längst tot ist, oder irgendwo dazwischen, wie bei Jünger, bei dem wohl der „Arbeiter“ eine überzeitliche „Gestalt“ ist, nicht aber der Bürger: Das Bürgerliche existiert nicht im vollen Sinn. Bei Ayn Rand (1905–1982) schließlich sind es nur die großen Einzelnen, die wahrhaft sind; alle anderen werden von der Gewissheit ihres Nichtseins heimgesucht.
Die extremen Rechten bemühen bis heute ganz ähnliche Motive: So gibt es die Rede von einem „Interregnum“, in dem wir angeblich leben, also einer bloßen Zwischenphase zwischen zwei wahrhaften, legitimen Reichen. Oder man erklärt, dass dies ja wohl nicht mehr Deutschland sei. Wenn man solche und ähnliche Phrasen abtut, macht man es sich zu leicht. Ich schlage deshalb vor, sie ganz wörtlich zu verstehen. Dann begreift man auch, weshalb das reaktionäre und rechte Denken so gut anschlussfähig ist für Verschwörungstheorien aller Art und jedweder Absurdität: Sie teilen ja die Grundvoraussetzung, dass das Erscheinende nicht volle Wirklichkeit beanspruchen kann.
Freilich, wenn man sich einmal in diese Lage manövriert hat, kommt man nicht mehr gut aus ihr heraus: Alle Hilfe im Realen muss verdächtig werden, da dieses selbst ja suspekt ist. Es bleibt letztlich nur eine literarische Strategie: eine Versicherung des schwindenden Seins durch die ästhetische Evokation. Da tatsächlich das Sein als solches unsicher wird, helfen nur noch die stärksten Gegenmittel, deshalb bedient sich der reaktionäre Diskurs intuitiv bei solchen Ausdrucksformen, die den Affekt des Erhabenen herstellen. Reaktionäres Denken ist also die Bewegung, die von dem Horror des Seinsverlustes mit den Mitteln der literarischen (Auto-)Suggestion in den Affekt des Erhabenen ausweicht.
Ein Vorteil des Begriffs des Reaktionären ist gerade, dass er im Deutschen kaum eine strenge Bestimmung hat. Dadurch ist es möglich, ihm eine präzise philosophische Bedeutung zu geben, die sich gewissermaßen im vorpolitischen Feld bewegt. Denn reaktionäres Denken unterhält deutliche Affinität zu rechter und rechtsextremer Politik und Ideologie, ist aber mit ihnen nicht identisch.
III. Macht – Nietzsche vs. Spinoza
PS: Besonders „wegweisend“ in dieser Hinsicht ist aus Ihrer Sicht ja Nietzsches Konzeption des „Willens zur Macht“ als Inbegriff der „wahren Wirklichkeit“ gegenüber den Scheinrealitäten der Sklavenmoral, der entfremdeten Welt des Nihilismus. Haben wir es dabei womöglich mit einem Modell reaktionären Denkens zu tun? Oder lässt er sich auch anders interpretieren?
RZ: Bekanntlich wurde er gerne und oft so interpretiert: als Freibrief für theoretische wie praktische Rücksichtslosigkeit. Man konnte dafür in der Tat auch Stellen bei Nietzsche finden; mir scheint, dass er selbst sich nicht ganz klar war, wie er den Willen zur Macht verstanden wissen wollte. Denn man kann ihm auch eine ganz andere Deutung geben: An vielen Stellen dekonstruiert Nietzsche die Vorstellung eines autonomen Handlungssubjekts und die Hypostasierung eines „Willens“. Stattdessen stellt sich die Wirklichkeit eher als ein unendliches Gewebe nicht Ich-hafter Zentren oder Knoten von Mächtigkeit dar, die miteinander in ununterbrochener Interaktion stehen. Unter „Macht“ kann man dann nicht sinnvoll Herrschaft oder Unterwerfung verstehen („potestas“/„pouvoir“), sondern gewissermaßen einen Wirkungskoeffizienten, der zugleich Wirklichkeit ist und schafft („potentia“/„puissance“). Wählt man diesen Weg, dann ist der „Wille zur Macht“ deutlich näher an Spinoza (1632–1677) als am Faschismus.
PS: Statt „Wille zur Macht“ also „Wille zum Können“ oder auch „Wille zur Wirklichkeit“? Folgt aus dieser „spinozistischen“ Lesart des „Willens zur Macht“ für Sie eine mögliche nicht- oder sogar antifaschistische Interpretation von Nietzsches gesamter Philosophie?
RZ: Ich fürchte, es gibt keine ganz geraden Wege von der Metaphysik zur Politik und umgekehrt; ebenso sollte man der Versuchung widerstehen, allzu eindeutige (v.a. politische) Kategorisierungen vorzunehmen. Gleichwohl führt die angedeutete Lesart des „Willens zur Macht“ zu einer Sicht auf das Wirkliche, die sich immer wieder ausdrücklich bei Nietzsche findet (und die ihn im Übrigen wieder mit Spinoza verbindet): In dieser Sicht herrscht ein absoluter Primat der Positivität im Sein. Wirkliches ist, und als solches bekräftigt es sich unablässig. Alle Negativitäten – egal ob es sich um das Ressentiment oder die Interpretation des Seins als Kampf und Krieg handelt – siedeln sich auf einer nachgeordneten Ebene an, die vor allem von den Erwartungen, Illusionen oder „Vergiftungen“ der Interpretierenden abhängen. Nietzsche formuliert dabei geradezu das Programm eines nicht-reaktionären Erhabenen, nämlich eines, das auf Grausamkeit verzichten kann:
Es gibt der erhabnen Dinge genug, als dass man die Erhabenheit dort aufzusuchen hätte, wo sie mit der Grausamkeit in Schwesterschaft lebt; und mein Ehrgeiz würde zudem kein Genügen daran finden, wenn ich mich zum sublimen Folterknecht machen wollte.6
Hier sehe ich jedenfalls keine unmittelbare Andockstelle für faschistisches Denken mehr.
PS: Um uns zu meiner Ausgangsfrage zurückzuführen: Wäre ein solches „nicht-reaktionäres Erhabenes“ dann vielleicht doch wieder mit einem emanzipatorischen Mythos, vielleicht besser: einer Utopie, der Positivität verbindbar? Der von Nietzsche freilich nicht sehr geschätzte französische Poet Charles Baudelaire (1821–1867) sprach in einem seiner Gedichte seiner Geliebten eine „Einladung zur Reise“ aus in ein Land, in dem gilt: „Dort ist nur Schönheit und Genuß, [/] Ordnung, Stille, Überfluss.“ – Sollten wir dieser Versuchung nicht doch Folge leisten? Könnten die Konzepte des „Willens zur Macht“ und des „Übermenschen“ vielleicht auch der Sehnsucht nach einem solchen befriedeten Nicht-Ort Ausdruck verleihen und als solche den emanzipatorischen Kampf beflügeln? Oder wären Sie da vorsichtiger?
RZ: Vielleicht sind solche „Mythen“ sinnvoll und berechtigt in einem strategischen Sinn: als Utopien, die die Kräfte mobilisieren und bündeln können, um dem Status quo wenigstens hier und da etwas abzuringen. Von einer rein philosophischen Warte aus jedoch kann ich sie, so sehr sie mich anrühren, nicht mehr teilen – was durchaus Anlass für die professionelle Melancholie ist, die mit der Philosophie oft einherzugehen scheint. Nicht nur halte ich die geschichtsphilosophischen Voraussetzungen, wie erwähnt, für bloße Kinder des Wunsches: So etwas wie einen Fortschritt gibt es höchstens in begrenzten Bereichen und für gewisse Zeitabschnitte. Doch solche Utopien scheinen mir auch eine Dimension menschlichen Lebens zu ignorieren, die etwa bei Nietzsche eine große Rolle spielt: das Tragische. Wir sind unzähligen Zufällen und Schicksalen ausgesetzt, unsere körperliche und seelische Organisation macht uns anfällig nicht nur für Krankheiten, sondern auch für die immergleichen zwischenmenschlichen Konflikte, deren Monotonie über die Jahrhunderte hinweg sie nicht weniger schmerzlich in jedem Fall werden lässt. Natur weist uns allenthalben Grenzen auf, die zwar nie scharf identifiziert werden können, deren Überschreitung sich aber oft rächt. Man kann das auch so ausdrücken: Wenn es die moderne Idee der Politik mit dem Unterfangen zu tun hat, die Bedingungen des Lebens und Zusammenlebens zu verändern und zu verbessern, dann gehört es zur philosophischen Aufrichtigkeit, dass nicht alles politisch sein kann, weil einfach nicht alles manipuliert werden kann. Es gibt freilich Hoffnung: Sie besteht in dem (je nach Geschmack) aufreibenden oder reizvollen Umstand, dass sich nie im Voraus sagen lässt, was veränderbar ist und was nicht. Man muss es wohl doch immer aufs Neue ausprobieren.
PS: Professor Ziegler, ich danke Ihnen herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch.
RZ: Ich danke Ihnen!
Robert Hugo Ziegler lehrt Philosophie in Würzburg. Er ist Autor mehrerer Bücher zu politischer Philosophie, Metaphysik, Naturphilosophie und zur Geschichte der Philosophie. Zuletzt erschienen im Jahr 2024 Kritik des reaktionären Denkens, Von der Natur und Spinoza und das Flirren der Natur.
Fußnoten
1: Dieser Begriff ist allerdings nicht unumstritten, da er nach dem Zweiten Weltkrieg von dem Ernst-Jünger-Schüler Armin Mohler mit der Intention geprägt wurde, deren Vertreter von ihrer Verstrickung in den NS bzw. den Faschismus reinzuwaschen.
2: Die fröhliche Wissenschaft, Aph. 377.
3: Vgl. insb. seinen Artikel Über die Geschichte des Urchristentums (Link).
4: Vgl. die Schrift Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats (Link).
5: Vgl. hierzu etwa auch Luca Guerreschi: „Die Philosophie der Kraft“. Mussolini liest Nietzsche. In: Martin A. Ruehl & Corinna Schubert (Hg.): Nietzsches Perspektiven des Politischen. Berlin & Boston 2022, S. 287–298.