Nietzsche POParts
Aren’t words and notes
like rainbows and bridges
of semblance,
between that which is
eternally separated?
Nietzsche
POP
arts
Nietzsche

Sind

nicht

Worte


und

Töne
Regenbogen
POP

und

Scheinbrücken

zwischen

Ewig-

Geschiedenem
arts

Timely Blog on Nietzsche’s Insights
Articles
_________
Nietzsche's Techniques of Philosophizing
With Side Views of Wittgenstein and Heidegger
Nietzsche's Techniques of Philosophizing
With Side Views of Wittgenstein and Heidegger
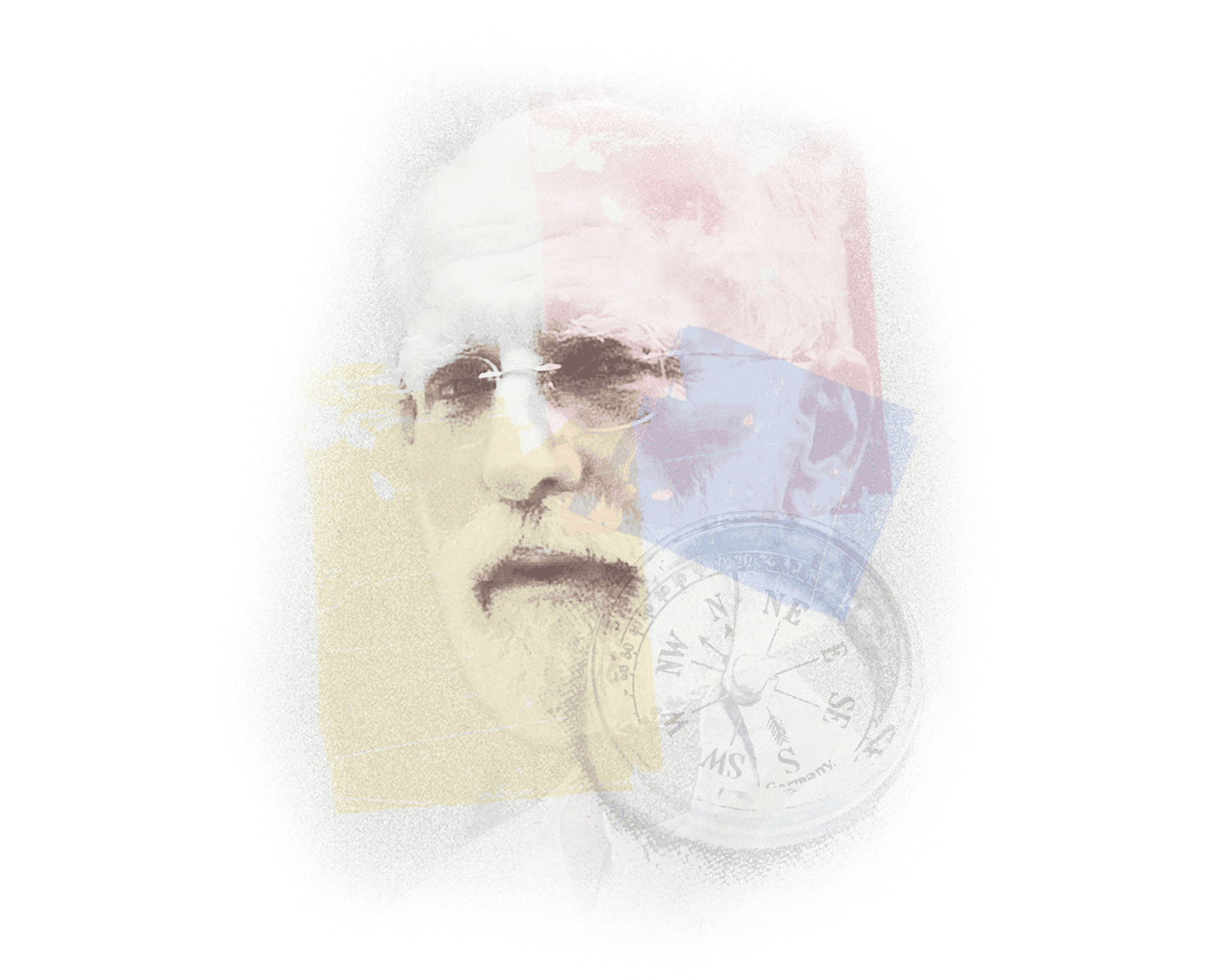

An integral part of the annual meeting of the Nietzsche Society is the “Lectio Nietzscheana Naumburgensis”, at which a particularly deserving researcher once again talks in detail about the topic of the congress on the last day and concludes succinctly. Last time, this special honor was bestowed on Werner Stegmaier, the long-time editor of the important trade journal Nietzsche studies and author of numerous groundbreaking monographs on Nietzsche's philosophy. The theme of the conference, which took place from 16 to 19 October, was “Nietzsche's Technologies” (Emma Schunack reported).
Thankfully, Werner Stegmaier allowed us to publish this presentation in full length. In it, he addresses the topic of the Congress from an unexpected perspective. This is not about what is commonly understood as “technologies” — machines, cyborgs, or automata — but about Nietzsche's thinking and rhetorical techniques. What methods did Nietzsche use to write in such a way that his work to this day not only convinces but also inspires new generations of readers? And what is to be said of them? He compares Nietzsche's techniques with those of two other important modernist thinkers, Martin Heidegger (1889-1976) and Ludwig Wittgenstein (1889-1951). In his opinion, all three philosophers say goodbye to the classical techniques of conceptual philosophizing founded in antiquity and explore radically new ones in order to try out a new form of philosophizing in the age of “nihilism.” A monotonous, metaphysical understanding of rationality is replaced by plural, perspective thinking, which must necessarily use completely different techniques. The article creates a fundamentally new framework for understanding Nietzsche's thinking and philosophical context.
I. Nietzsche's Fascination with the Techniques of his Philosophizing
Nietzsche said of Socrates, his great antipode, that he “fascinated” the noble Athenians with his dialectic — with it he “had a merciless tool in his hand,” with which he had the intellect of his opponents.”depotentiated”1 Have. For Nietzsche, dialectics, and with it the entire rationalism of Western philosophy, was a technique with which a semblance of truth could be produced. In his time, as he soon realized for himself, the “conviction” had prevailedthat we don't have the truth”2, what he then called “nihilism.” After a long struggle for its meaning and consequences, he finally recognized in him the “normal state,”3 In which, according to metaphysics, we are now living again, a state in which what metaphysics and the subsequent Christian dogmatics declared to be top values loses its credibility. When he saw that there were no more absolute certainties, Nietzsche consistently demetaphysized and demoralized the language of philosophy in order to reach a new “deepening into reality”4 , which we are only reluctant to understand because we ourselves are still attached to metaphysical-moral idealizations.
As we see today, Nietzsche did not construct a new “system”; as is well known, “the will to the system” was already a “lack of righteousness.”5. The famous doctrines, which, according to Heidegger in particular, should be the core of such a system, the doctrines of superman, of will to power and of the eternal return of the same, he put in the mouth of his figure Zarathustra, but let him consistently fail with them — no one, not his disciples, not his animals, not the higher people, does not understand them in his mind, and in the end goes He alone opposes his sign intended only for him. Under his own name, Nietzsche led in Beyond good and evil (Aph 36) introduces the concept of the will to power as a mere hypothesis of parsimony of principles, as a means of making the new picture of reality as clear as possible (“and nothing else”). Here, as can now be clearly seen from the new edition of the late estate, he had initially acted on the eternal return of the same and only then used the will to power in its place.6 The two hypotheses seemed to him to be functional equivalents for the radical reorientation of philosophy that was taking place in nihilism. For him, they were not dogmas, but part of the technique of his philosophizing.
They were also discontinued as dogmas. There was no such thing as a Nietzsche School, comparable first to the Hegel School and then to the Kant School in the 19th century. Instead, the Nietzsche interpretation has now learned not to base his philosophizing on specific doctrines, but to follow his orientation process with all its facets and all the ambiguities and turns that he takes, to observe Nietzsche at work.7 We can try to learn from this how to orient ourselves in nihilism and attract readers all over the world in return. In the spirit of the topic of this conference, I will explore the techniques of Nietzsche's philosophizing in order to find out how, in the normal state of nihilism, he gained a sense of orientation that still fascinates today.
In order not to remain fixated on Nietzsche's philosophizing, I also take a side look at the philosophizing of Heidegger and Wittgenstein, which were the most innovative in the 20th century. Both were born in 1889, the year in which Nietzsche went insane. Wittgenstein took note of him rather distanced; Heidegger built him up as a major opponent in order to profile his own “other start” against him.8 But both achieved something very rare and great, which Nietzsche would have called “self-overcoming”: They overturned the foundations of their own first philosophies, with which they had become world-famous. Wittgenstein recognized in his Logical-philosophical treatise, with which he the “inviolable and definitive””verity“in order to solve philosophical problems, he believed he had achieved a doctrine that could not be maintained, Heidegger in Being and time a missed step on the path to “meaning of being.” Instead, they in turn looked at the techniques of philosophizing: the ways and means by which it can lead to doctrines and those by which it can abstain from them. Like Nietzsche, they now spoke more about their “philosophizing” than about their “philosophy.” They too disregarded traditional standards of philosophizing and created radically new ones. And like Nietzsche, they did not have a preconceived plan that they would have worked through systematically, but deliberately accepted surprises in their own thinking as well. They all came not to a goal with their philosophizing, but only to a temporary end. And yet they achieved the most powerful effects.9
II. Skillful Use of the Most General Terms as a Technique of Philosophizing in General
Techniques are not something you believe to be true; you judge them solely on the basis of their functioning and success. Technology is also not, as the late Heidegger said, suspicious of metaphysics; because it is not just mechanical technology, which Nietzsche, as we have heard, liked to use and which Wittgenstein, as a student of engineering, dedicated himself so intensively that he came to philosophy through mathematics. Techniques are also, for Nietzsche and also for Wittgenstein, techniques of composing and making music, of poetry and thus also of philosophizing. After Nietzsche, Greek tragedy poets were able to learn techniques from each other10 Can you acquire techniques in education11 Richard Wagner “profoundly overcome the scholarly and transformed it into instinctive technology”12; Nietzsche also speaks of techniques of trade, hunting13 and linguistic expression14. In an overview from the end of 188715 He cites “the great technology and inventiveness of the natural sciences” as a means against the “moralization of everything up to now. Philosophy {and appreciation}”, Christian idealization (“e.g. {in music}, in socialism”), Rousseau's “hatred of aristocratic culture,” against the romantic “wrong and imitation of stronger humanity,” and finally against “hatred” of “all kinds of ranking and distance.” Like all that, “{what {relatively} was born from abundance in the 19th century, with pleasure}”, be technology, in addition to “{cheerful music, etc.}” and perhaps also the “{history (?)} “, a “{relative [s] product [] of strength, self-confidence of the 19th century}”; it gives new orientation in our language that makes nihilism bearable. On the other hand, as Nietzsche then said in The Antichrist (#44) writes that in Christianity, the “technique,” the “art of lying saintly, [...] came to ultimate mastery.”
Techniques in this sense are practices that do not have to be conscious, but on the contrary, if you become aware of them as such, when playing the piano or during simple movements such as walking, can even be disturbed, as Kleist does in his famous essay About the puppet theatre described; Nietzsche wrote about how difficult it is often to talk about his techniques.16 They are learned through experiments and put into practice until you “can” at some point, without having to be able to explain why you can. You can learn them by observing them in others, but you can't easily teach them because everyone has different skills with them. In any case, they must be “skillful,” and philosophizing must also be skilled in this sense. As with any other craft, the best judge whether it is done skillfully is those who can do it themselves.
The late Wittgenstein noted for himself: “We go through conventional thought movements, make, automatically, thought transitions in accordance with the techniques we have learned. And now we have to review what we've said first. ”17 The late Heidegger also emphasized that the “craft of thinking” must be learned and practiced.18 This results in a “technical” concept of philosophy itself: no longer determined by predetermined objects such as world and truth, being and time, but as a skilled use of the most general concepts of this kind. And now you can observe what goes into this skill, i.e. using the examples of Nietzsche, Wittgenstein and Heidegger.
III. Nietzsche's Techniques of Philosophizing
A. Nietzsche's Techniques as an Answer to Specific Problems
In connection with Nietzsche's characterization of Socrates's “Magic of the Extreme,” I have already shown how, in the course of his work, he himself responded to certain problems that faced him with certain techniques for solving them.19 I came up with seven there:
1st in the Birth of Tragedy he answered the problem of the “theoretical man” created by Socrates with the technique of embedding it in the simultaneously newly understood Greek culture;
2nd in Human, all-too-human on the problem of the entire government of the world with the technique of comparing cultures in an “age of comparison” (Vol. 1, Aph. 23);
3rd in Morgenröthe on the problem of the self-denial of European morality with the technique of a moral critique of morality, which then became the genealogy of morality;
4th in The happy science on the problem of nihilism with the technique of reorienting philosophizing from the ground up through the integration of art;
5th in Beyond good and evil on the problem of the will to truth, which persists even when you know that you cannot have the truth, with the technique of expanding the horizons of human orientation (all “basic human instincts” have “driven philosophy before” [Aph 6]);
6. in the V. book of Happy science on the problem of ranking (including in law on problems) in a time of unstoppable democratization with the technology of switching from equality to difference;20
7th in Götzen-Dämmerung and the last works prepared for publication on the “Problem of Werth of life in general” (Morality as an offense, 5) using the technique of affirming everything that is happening or liberating yourself from resentment21.
All these techniques — embedding, comparison, self-referential criticism, integration of art, broadening horizons, breaking with familiar equations and affirming the given — increase the scope of Nietzsche's philosophizing and at the same time give his philosophizing its own footing. In this sense, they are orientation techniques.22 You always orient yourself at something without already committing to it, and Nietzsche is also philosophically oriented in the mode of question and provisional. With Nietzsche, the truth that you “can't have” becomes part of the game, a “meeting [...] of questions and question marks.”23that, according to all experience, it actually is. According to this, philosophizing as a skillful use of general terms is a technique of orienting oneself in the world that always remains questionable, always provisional. It includes constant watchful self-criticism, in Nietzsche's language unremitting “self-overcoming.”
To a certain extent, these techniques can also be applied to Wittgenstein and Heidegger. However, this is more obvious with
B. Nietzsche's Techniques of Philosophizing in General
I'll name 7 techniques again. We need to see how far we want — and can — follow them today.
1. Radical Destruction of Dogmatic Truths — up to Nihilism
Nietzsche and thus also Wittgenstein and Heidegger in their late period consistently destroy the dogmatic truths of almost all previous philosophy apart from Heraclitus. You can't start over in philosophy without cleaning up the old. However, you can do it in the literal sense of lat. Destroy only gradually “shift off” because it could still guide thinking. All three no longer approach destruction systematically as did Hegel, but attack point by point where traditional doctrines seem to impede their philosophical reorientation, and are mostly aimed at people such as Socrates, Plato and Aristotle, Augustine, Descartes, Spinoza, Kant and Hegel, but always with regard to standards of philosophizing that have become self-evident such as logic with their principle of excercising conclusive contradiction or the epistemological isolation of assets such as sensuality, reason, feeling and will. They all not only allow logical paradoxes, but actually rely on them, Nietzsche, for example, on the certainty of uncertainty,24 vital falsehoods,25 teaching the unteachable (cf. the entire Zarathustra), communication of the indivisible26 and accepting the unacceptable (Amor Fati),27 Wittgenstein on the game with rules in regulated language games, Heidegger on the incomprehensibility of the all-important Seyns, which he — alienates with y — writes down and repeats at the same time. They all follow Heraclitus, who stuck to the time that doesn't last, Socrates, who knew that he knew nothing, and Plato, who wrote that he did not write down doctrines. Nietzsche also morally attacks seemingly unassailable morality insofar as she, lying herself, forces philosophizing to lie.
The gain of the technique of destruction, which Heidegger expressly calls as28 is the liberation for new clues and horizons, ways and standards and sensitivities of philosophizing beyond system boundaries. In the case of Nietzsche, these include physicality, instincts, moods, rhythms, which he contributes to the “music of life.”29 summarizes, orientation also towards other cultures and languages, vital deceptions and self-delusions, the great seriousness of playing with everything. By destroying the one-dimensional Augustinian image of language, the late Wittgenstein achieved a breakthrough in looking at the manifold functions of language in the fields of diverse forms of life and at the techniques of assurance that arise in them. In order to clear the sense of being freed from ontological requirements, the late Heidegger envisages the “playback” of “other beginnings” in a “profound”, baseless “time-game space” into which thinking must find its way into.30
2. In-depth Deconstruction — for the Immediate Plausible
Only destructive philosophizing would be completely baseless; it must continue constructively at the same time. Derrida has happily brought destruction and construction together in the term deconstruction and at the same time warned against seeing it as a generalizable method.31 The technique of deconstruction, as used by Nietzsche, Heidegger and Wittgenstein, is also different at work in any case, and this also applies to the gradual deepening of the terms in Hegel's dialectic. It abolishes previously acquired concepts in such a way that it constructively continues to “deeper” units of seemingly mutually exclusive opposites. In this way, contradictions and paradoxes also become productive for philosophical orientation. With the technique of deepening, the terms gain a foothold to each other, without them being able or having to be attached to any “to themselves.” Anhalt is always the immediate plausibility of the respective “deeper”, repealing the previous term. For Nietzsche, this is the concept of life. Because philosophizing itself also moves in life: “Up to now, all philosophizing has not been about 'truth' at all, but about something else, let's say about health, future, growth, power, life...”32 With the concept of life, Nietzsche includes in the philosophical orientation everything that the concept of pure thought had excluded from it as uncertain and baseless, first and foremost the corporeality and sensuality and then more and more the incomprehensibly intertwined contexts and complexities of everything that is experienced and experienced in the world. Nietzsche in turn deepens the concept of life into that of the will to power and in doing so expressly follows that of the old Occamian technique of parsimony of principles.33 For example, he uses “will to power” not as a metaphysical term but as a technical term, as a technique of consistent conceptual work, and at the same time he has virtually electrified a large audience with his immediate plausibility.
In the midnight song, the Nietzsche at the end of III. and Part IV of So Spoke Zarathustra How a solution to all philosophical and perhaps even everyday problems comes in and which, attached to a towering rock on the Chastè peninsula in Lake Sils, leaves walkers standing spellbound day after day, he most impressively demonstrates his technique of deepening.34 Here he makes “deep” himself the motto — it appears eight times in eleven lines — for the unity of life with its contrasts of day and dream, pain and pleasure, passing away and eternity. The depth of philosophizing, which you can immediately feel here, is completely without reasons in the song; even the concepts of life and will to power no longer appear, and the “deep, deep eternity” is also not that of the return of the same, but of pleasure, the joy of life, and the midnight song renders A desire to live.
In the language of the late Heidegger, there is a deepening of the terms that give support to philosophizing, in “additions,” which also guide it into “abscesses.” He develops his own poetic language, in whose additions and additions the forgotten Seyn can be heard in silence instead of logically comprehensible and thus immediately plausible. Wittgenstein, for whom logic initially “had a particular depth — general meaning —” as if it were “at the bottom of all sciences.”35, then sees, having become skeptical of everything profound in philosophy, that “the depth of the essence”, which is presumed here, only “the deep The need for agreement” meets.36 “Deep meaning” gets something from an “environment,” a specific context that gives it “importance,” that's all.37 In particular, the philosophically appreciated technique of seemingly deepening human observation into an interior, the justification of observable actions through unobservable “emotional” or “mental processes,” seemed to him to be a “sleight of hand.”38 Nietzsche would probably not have contradicted this.
3. Strategic Generalizations — to the Extreme
Deepening terms is also a technique of generalization. With terms in general, you detach yourself from the situation in which they are needed and gain a further overview; with the progressive deepening and generalization of concepts, you can better understand the current situation in which you are standing and start with it more and more. Philosophy, with its most general terms, seeks an overview of the whole of world events in order to be able to intervene in it whenever possible.
Since Aristotelian metaphysics, it was believed that there was a firm basis for a pyramidal structure of ever more general concepts; at the top was the completely empty concept of mere existence. Nietzsche, Wittgenstein and Heidegger break with it and unmask the abstraction Genus proximum and Differentia specifica as a mere orientation technique.39 Because you can generalize terms from any point in different directions and to different degrees, but you must also be responsible for each of these generalizations yourself. You can't get by without generalizations, neither in everyday life nor in philosophy. But you don't call up an inherently existing general concept, but always make the generalizations strategically according to specific needs.
Nietzsche has denounced the typical “philosopher rage of generalization” with his teacher Schopenhauer: He made the “poetic metaphor” of blind will from the “approximate finger pointing” of intrusive and penetrating sexual will, asserted the ill-meaning “primacy of will over intellect,” and “misused into a false imitation”; “all fashion philosophers” would then have continued to paint and spread the “mystical nonsense.”40 Instead, Nietzsche described his own philosophizing as “a dizzying expanse of review, of what has been experienced, guessed, deciphered,” and at the same time as “{the will to result}, fearlessness in the face of harshness and dangerous consequence.”41 Without metaphysization and a pyramidal structure of the terms, he pushes the technique of generalization to the extreme.
He addresses this himself in his Lenzerheide recording, in which, after completing Beyond good and evil and the 5th book of Happy science, seeks to provide an overview of the guiding ideas of his own philosophizing.42 There he observes how the extreme of belief in the one omniscient, omnipotent and just God, who has given human orientation an absolute certain footing, is now turning into the extreme of belief in a complete lack of order, senselessness and worthlessness of existence, which must become the will to destroy all orders and self-destruction among the mass of now helpless and disoriented people. Here, he gives his idea of eternal return and the will to power the function of strategically increasing this extremization: On the one hand, they should destructively aggravate discouragement and paralysis and, on the other hand, constructively provoke a new “ranking of forces.” They are consistently no longer based on truth but on effect.
The “magic of extremes”43 The reason is that it immediately fascinates for no reason, even if there are enough reasons to the contrary. According to the Lenzerheide recording, the previous “'God' [...] was also far too extreme a hypothesis.”44 But all statements are extreme, even this one, philosophizing as such turns out to be an extreme company. Like the concept of a God who dominates the whole world, concepts such as “pure reason” and “transcendental subject,” with which the whole rest of the world is excluded, and also “will to power” — and nothing else.”45 extreme generalizations; Zarathustra, Nietzsche's figure of the philosophical teacher, is more spiritual and physical superiority.46
But even extremization alone doesn't do it, precisely because one extreme can always turn into another. You also have to handle it skillfully. As is well known, Nietzsche concludes the Lenzerheide record: According to this, “the most moderate, those who do not need extreme beliefs,” prove to be “the strongest.”47 The strongest philosophical technique of philosophizing would therefore be to think extremes without falling prey to them, but simply to orient oneself on them. If you don't commit to them, you can experiment with them, do thought experiments. So did Nietzsche in the Happy science (Aph 109) tries to think of complete chaos, in which there is still no law and there is no order, i.e. an extreme nihilistic state, in order to see what then becomes possible, and finally considered as a counterextreme the “great ambition” of “[over] the chaos [to] master {that you are}; force this {his} chaos to become form; necessary {[to become] in form: logical, hard, terrible, slow, simple, law {simple, unambiguous, math [] law”.48 When extremes in philosophizing have the purpose of opening up extreme leeway for it, Nietzsche programmatically combines the biggest and farthest with the smallest and nearest, ties the most general back to the most concrete. With this technique, he also gives his far-reaching philosophizing everyday plausibility.
However, large leeway also means uncertainty and uncertainty of orientation, both in everyday life and in philosophy. For the late Wittgenstein, “in every serious philosophical problem [...] uncertainty goes down to the roots./You always have to be prepared for something wholly To learn new things. ”49 In this way, he makes a virtue out of necessity and questions the need for orientation in philosophizing himself: “Only if you think much more crazy than philosophers can you solve their problems. ”50 Heidegger, too, expressly does not want to seek security anymore after saying goodbye to metaphysics. He notes in his Black booklets: “Rejection of all security and uncertainty — which only stems from the uprising of the human being's selfishness,” the will to power in Heidegger's metaphysical interpretation.51
4. Personal Perspectives — up to the Compromising
Productive philosophers in particular are alone for a long time with their large-scale intellectual experiments — the larger the experiments, the less others dare to participate in them. Summit talks among contemporaries are also rare and rarely fruitful; after Lou Salomé and Paul Rée, Nietzsche found no one with whom he could philosophize on equal terms, Heidegger and Jaspers soon became estranged, and Heidegger and Wittgenstein completely ignored each other. Everyone complained of not being understood for the time being.
In nihilism, as a normal state, you are ultimately dependent on your own orientation. Right from the start, Nietzsche has courageously brought his own person into play, particularly strikingly in the Untimely considerations; Lastly, in the new prefaces and in Ecce homo, he puts his person in the foreground. When he explains his “war practice” here, he also includes the strategy or technique of “compromitizing” himself52: All who philosophize unavoidably reveal a particular point of view. Even if you try to hide behind the apparent consensus of a “man” or “we,” you find yourself among “good friends,” which Nietzsche also sometimes quotes, in a “playroom and playground of misunderstanding.”53. It could be a positive part of Nietzsche's effect that he openly and honestly acknowledges the personal nature of his philosophizing and also describes how he comes to his thoughts — not while sitting at a desk, but on long walks — how the thoughts suddenly arise and develop only gradually, how they learn to fly, but can also get on tracks from which it is difficult for them to get out again. For a “will to the system,” this is compromising; for a philosopher like Nietzsche, it creates trust in his sincerity.
As is well known, Nietzsche philosophically goes from “phenomenalism and perspectivism.”54 out of all orientation. He makes a virtue out of the necessity of nihilism as the loss of all general certainties: the technique of “hanging out and including” perspectives and thus “making use of the diversity of perspectives and interpretations of affect for knowledge,” beyond “the dangerous old myth of terms, which is a “pure, willless, painless, timeless subject of knowledge,” a “pure Reason,” “absolute spirituality,” “knowledge itself.”55 This is how everyone faces philosophical problems differently. According to Nietzsche, this is again a question of “whether a thinker personally addresses his problems, so that he has his fate, his distress and also his best luck in them, or else 'impersonal. '”56 In nihilism, you can only be convinced that you stand by your points of view, horizons and perspectives in philosophizing.
Heidegger and Wittgenstein didn't go that far. As has become standard in the course of the scientification of philosophy, they keep their person out of their writings as much as possible or limit personal statements to prefaces. The late Heidegger wants to let Seyn speak for himself; in his popular short dialogues, the late Wittgenstein regularly keeps readers in the dark as to which side he himself is on.
5. Elastic Language — in Extreme Conciseness
With his language skills, Nietzsche is able to make what he writes immediately plausible, usually without further explanation. He deliberately uses the movement of terms along metaphors, which he has already identified in About truth and lies in an extra-moral sense had made it clear and most recently in On the genealogy of morality brings to the concise clause: “The form is fluid, but the 'meaning' is even more so...”57. Terms are convincing, especially when they are not terminologically fixed, by the fact that they in turn live, go through “more or less profound, more or less mutually independent processes of overwhelming taking place on [them]” (ibid.), in short that they move with the time in which the orientation itself changes, while rigid definitions quickly prove inadequate and inhibiting. In one word, Nietzsche forms elastic terms, as Wittgenstein then calls them.58 In order to be able to address different topics differently, Nietzsche uses diverse forms of philosophical writing, treatise, essay, book of aphorisms, dialogue, teaching poetry, disputed and song like no other,59 and shapes them all with a musical design technique, because music as such is convincing.60 It includes the technique of linguistic abbreviation, of conciseness; Nietzsche prides himself, perhaps rightly, of being the greatest master in using a “minimum in the volume and number of characters [...] a maximum in the energy of the characters”61 to achieve. In addition, there is his technique of “making believable” through images and parables, with which you “convince” without trying to “prove”, precisely where, unlike in science, there is nothing really to prove.62
Wittgenstein was, it seems to me, equal Nietzsche in his linguistic conciseness. Like Nietzsche in aphorism books, in which you can easily switch between topics and contexts and bring up new insights in a flash (“I can handle deep problems, like a cold bath — quickly in, out quickly”63), Wittgenstein philosophized in his late period only in scattered “remarks,” which he put together in “albums,” such as “landscape sketches,”64 In which everyone must orient themselves. He deliberately uses his later guiding concepts “language game”, “way of life” and “family resemblance” to everyday language and uses them in moving spaces without ever strictly defining them. Because it can be assumed that the most suitable means of communication for orientation will be established over time, especially in everyday language, he remains as close as possible to her in philosophizing. He even surpasses Nietzsche's Heraclitism by, in his last remarks, About certainty The image of the river, into which you do not climb twice, develops into the image of the riverbed, which in turn is constantly changing as the river flows: Not only human orientation itself, but also its framework conditions are constantly changing.65 And Wittgenstein also saw himself primarily as the inventor of new parables.66
The late Heidegger turned the technique of avoiding mechanized terminologies and instead turning everyday language philosophically into a new way into mania in order to let the ineffable and uncontrollable “Seyn” speak: by going back to the word roots and giving them deeper and more allusive meanings in which they added themselves in a surprising way.67
6. Fits of Mere Clues — in Greatest Density
The Platonic Socrates68 Set himself apart from the sophists by distinguishing persuasion from rhetorically trained persuasion working with defined terms and mutually recognized arguments, and thus founded philosophy as an independent discipline. Aristotle worked on this in his Topik and his analytics the standards of logic, on which he also built his metaphysics. For Nietzsche as well as for Heidegger and Wittgenstein, the standards of logic restrict philosophizing from the outset, precisely because the terms are always in flux even in philosophical language, as is the case today Historical dictionary of philosophy69 shows enough. In addition, the terminological fixation of the terms through definitions also leads back to undefined terms, and arguments are convincing, as Plato did in dialogues such as the Protagoras or the Gorgias shows, never all, i.e. not in general. They are “good” when they 'fit' in certain situations, i.e. when they convince the respective interlocutors with their respective points of view, horizons and perspectives. “Passing” is the deeper unity of the contrast of “persuasion” and “persuasion.”
The criteria for the fit can be very different. Aphorisms in aphorisms books must fit together without following apart. In Nietzsche's “Happy Science,” they fit together according to artistic criteria. “You are an artist at the price,” he notes recently, “that you perceive what all non-artists call form as content, as the thing itself.” With this, he adds, “you certainly belong in a wrong world. ”70 However, this is not as new and wrong as it seems. Even for Aristotle, who pioneered the correlation of form and content for European philosophy, form has the greater weight: after him, it shapes the content, first gives them recognizable form, and this form, which appears in living beings in their constant appearance (eīdos) and in the constant evolution of the individuals of a species, is a very real and clear clue for the formation of lasting concepts and thus also the basis of systematic philosophies in today's sense. Aristotle merely metaphysically hypostasizes the forms into eternal beings (Osiai), which is no longer sustainable today.
Post-metaphysically, we are dealing with well-rehearsed fits in observing clues such as individual and general appearance, words and facts, words, images and concepts in sentences, sentences in texts, arguments in evidentiary processes, shapes and colors, landscapes and moods, feelings and facial expressions, etc. to the matching of individual people into groups and societies. Adaptations are constantly evolving and can take on ever new forms. According to Nietzsche, you tailor your world to suit your needs and expectations; in the sense of his concept of will to power, these are fits at almost any price:
The Epicurean chooses the situation, the people and even the events that suit his extremely irritable intellectual nature; he dispenses with the rest — that is, most of it — because it would be too strong and heavy a diet for him. The Stoic, on the other hand, trains himself to swallow stones and worms, broken glass and scorpions and to be without disgust; his stomach should finally become indifferent to everything that the coincidence of existence pours into him [.]71
Nietzsche noted earlier, “ethical needs must suit us! ”72
In our orientation, we only have clues that we stick to for the time being, because there can always be an infinite amount behind them; we trust them all the more the more they fit in with others in a particular situation from a particular perspective. If they fit together well enough, they become plausible, you can 'do something with them, 'as Wittgenstein and Heidegger like Nietzsche like to say. This is also true in philosophy as well as in everyday life. If you activate methods here, they too must match the respective subject and subject area in order to be convincing. It is therefore a common, albeit mostly unnoticed, technique of philosophizing to find the right thing in each case and, if it is not found, to himfind. In the end, it's like Wittgenstein, who works very heavily with the concept of fit,73 at a central location of its Philosophical Investigations writes in order to “concise presentation” (No. 122). Heidegger has formulated this more poetically and pathologically with his language game of “additions” and “joints”: “All joining of the structure only comes from compliance to fug. ”74 For Heidegger, even if he wouldn't call it that, the technique of clearing the Seyns is the fit. But no one has found such rich and, above all, completely everyday and immediately plausible clues for his philosophizing, which fit together so convincingly without being systematically reconstructable as Nietzsche. The density of its fits is convincing as such.
7. Generating Pathos — by Referring to the God Dionysus
After all, philosophizing includes pathos, and no one understood the technique of pathos as well as Nietzsche. Even the high or low generality of the terms used by philosophy creates a sublime atmosphere. Elegance is increased when you ascend to the divine. Nietzsche, Heidegger and Wittgenstein are still doing this too, and perhaps especially in nihilism, albeit in very different ways. Wittgenstein is committed, but only personally and primarily in his Secret diaries and letters, believing to God, the Christian God who supervises and punishes man's sinfulness, but also gives him unshakable support. Wittgenstein consistently keeps him out of his philosophizing. This makes him skeptical of all pathos in philosophy:
“Language (or thought) is something unique” — this proves to be a superstition (not a mistake!) , caused even by grammatical deceptions. And pathos is now falling back on these deceptions, on the problems.75
Heidegger, on the other hand, who has decisively rejected Christianity, expects in his late philosophizing with the “only” poet Hölderlin for him once again a completely different one than the Christian one, the “last god” of a new and “different beginning” of philosophizing.76 The “decision on the flight and arrival of the gods” was “the opening of a completely different time space for one, indeed the first established truth of Seyns, the event.” It should be a god who silently passes by and remains strange and unpredictable and who only gives a “wave” for a new orientation from the ground up. According to Heidegger, it should be “purest seclusion and highest transfiguration, the most fair and the most terrible rapture” and also need the Seyns himself, which must thinning itself out of its own accord. But “large and hidden individuals” would have to prepare this clearing “in advance” with their philosophizing.77
Such pathos makes you shiver and seize, whether it has factual support or not. On the other hand, Nietzsche almost happily proclaimed Dionysus the god of his philosophizing.78 Dionysus is his idea of a god who can constantly destroy and add new things and, as we could say now, make them fit together in unfathomable ways and, with such abilities, can confidently orient himself even in nihilism. Nietzsche openly turns the pathos and paradox of metaphysics into a god from whom you can understand everything without understanding him yourself into a technique of philosophizing. In Aphorism No. 56 of Beyond good and evil He describes the — initially unnamed — God as “the ideal of the most exuberant, lively and world-affirming person, who has not only come to terms with and has learned to come to terms with what was and is,” who justifies it and”As it was and is“I want to have it again, for all eternity.” The idea of the eternal return of the same can only be understood from a divine point of view. If you accept it, the whole world situation, which fascinates and irritates people so much, may repeat itself over and in the end has no meaning, becomes a play in a Greek amphitheatre, in which you look down at what is happening in the orchestra from elevated ranks, taking part in it and listening to it and at the same time staying at a distance from it. And Dionysus was The god of theatre, the Athenians had built it in his honor, him who “just needed this spectacle — and makes it necessary — —” (ibid.). And philosophy remained committed to him: When you try to survey world events in a philosophizing way, you unavoidably adopt a divine standpoint. Dionysus, however, that is how Nietzsche then models him in Aphorism No. 295 of Beyond good and evil, in which he declares him the god of his philosophizing, at the same time knows “to descend into the underworld of every soul,” sees himself as a theatre god on every mask and every appearance and, by having the game performed with them, adheres to “daring honesty, truthfulness and love of wisdom.” He loves people, Nietzsche has him say in a staged dialogue, because he “is still finding his way around all labyrinths.” But that is just another word for orientation, in this case for philosophical orientation. A Dionysian philosophical orientation keeps everything open, always dares to make new beginnings and uses a wide variety of techniques to observe world events, and Nietzsche sees part of God in being “always many steps ahead of man” so as not to let him get stuck in any stipulations, convictions, dogmas that he so needs.
In the end, however, Nietzsche also reveals his appeal to a god, this tempting and devious god Dionysus, as a mere technique of his philosophizing. Because the gods in their grandeur never had to learn to orient themselves and therefore did not need to philosophize.79 And this is how, Nietzsche concludes the aphorism, “in a few pieces the gods can go to school with us humans.” The gods, to whom people so fondly obey when philosophizing, must in turn stick to people — “circulus vitiosus deus”80.
As a way of orienting oneself, every philosopher knows that it is bound to an earthly point of view. It can also remain sober and unpathetic today.
Werner Stegmaier, born on July 19, 1946 in Ludwigsburg, was professor of philosophy with a focus on practical philosophy at the University of Greifswald from 1994 to 2011. From 1999 to 2017, he was senior associate editor of Nietzsche studies. International Yearbook for Nietzsche Research, the most renowned body of international Nietzsche research, as well as the important series of publications Monographs and texts on Nietzsche research. He published numerous monographs and anthologies on Nietzsche's philosophy and philosophy in general, in particular his Philosophy of orientation (2008), then Luhmann meets Nietzsche. Orientation in nihilism (2016) and recently Wittgenstein's orientation. Assurance techniques (2025). The development of the “philosophy of orientation” he founded is his current focus of work. Further information about him and his work can also be found on his personal website: https://stegmaier-orientierung.com/
Bibliography
Derrida, Jacques: force of law. The “mystical cause of authority”. Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1991.
Heidegger, Martin: Notes I-IV (Black Notebooks 1942-1948). Complete edition Vol. 97. Frankfurt am Main (Klostermann) 2015.
Ders. : Posts (from event). Complete edition Vol. 65. Frankfurt a. M. (Klostermann) 1989.
Ders. : Being and time. Tübingen (Max Niemeyer) 1986.
Kaiser, Katharina U.: Discussion with Hölderlin I. In: Dieter Thomae (ed.): Heidegger handbook. Life — Work — Impact. 2nd, revised & adult Edited by Stuttgart & Weimar (Metzler) 2023, pp. 184-188.
Marafioti, Rosa Maria: Heidegger's “Black Notebooks.” Seynsdenken and our history. Freiburg & Munich (Alber) 2024.
Müller, Enrico: The pathos of Zarathustras. In: Gabriella Pelloni & Isolde Schiffermüller (eds.): Pathos, parody, cryptomnesia. The memory of literature in Nietzsche So Zarathustra spoke. Heidelberg (winter) 2015, pp. 11-31.
Rauschelbach, Uwe: The singing soul. Thinking and writing “through” music in Nietzsche. In: Nietzsche research 29 (2022), PP. 85-118.
Summer, Andreas Urs: Comment on Beyond good and evil. Historical and critical commentary on Friedrich Nietzsche's works, ed by the Heidelberg Academy of Sciences. Volume 5/1, Berlin & Boston (Walter de Gruyter) 2016.
Stegmaier, Werner: Aspects of Reception and Impact [Nietzsche]: Philosophy. In: Nietzsche handbook. Life — Work — Impact. 2nd, completely reworked edition, ed. by Robert Krause, Andreas Urs Sommer and others Stuttgart & Weimar (Metzler) (to be published).
Ders. : The “magic of extremes” in philosophical reorientations. Nietzsche's new extreme problems and solutions and the old example of Socrates. In: Nietzsche studies 50 (2021), PP. 1-25.
Ders. : Friedrich Nietzsche on the introduction4., renewed edition Hamburg (Junius) 2024.
Ders. : Forms of philosophical writings for introduction. Hamburg (Junius) 2021.
Ders. : Nietzsche at work. The weight of his discontinued notes for his philosophizing. Berlin & Boston (De Gruyter) 2022.
Ders. : Nihilism and other beginnings. Paths to a new orientation. In: Holger Zaborowski (ed.): Heidegger and the question of nihilism, in: Yearbook of the Heidegger Society (forthcoming).
Ders. : Philosophy of orientation. Berlin & New York (de Gruyter) 2008.
Ders. : Being to death — living with death. Ein Holzweg Heidegger. In: Eike Brock, Günter Gödde, Dennis Sölch & Jörg Zirfas (eds.): Heidegger and the art of living. Berlin (Springer/Metzler) 2025, pp. 143-160.
Ders. : What does the deep midnight say? Explanations of Nietzsche's poem “Oh man! Pay eight! ”. row Read Nietzsche, ed. by Timon Georg Böhm, issue 2, Nietzsche House Foundation in Sils-Maria 2017.
Ders. : Philosophize like a god? Nietzsche's reference to Dionysus as the god of his philosophical orientation. On aphorism No. 295 from Beyond good and evil. In: Jan Kerkmann (ed.): Philosophy of religion according to Nietzsche. The loss of truth and the search for God. row New horizons of religious philosophy, ed. by Michael Kühnlein, Stuttgart (Metzler) (forthcoming).
Ders. : Wittgenstein's orientation. Assurance techniques, Frankfurt am Main (Klostermann) 2025.
Wittgenstein, Ludwig: Remarks about the colors. In: Edition of works Vol. 8. Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1984.
Ders. : Remarks on the basics of mathematics. Edition of works Vol. 6 Frankfurt am M. (Suhrkamp) 1984.
Ders. : Remarks on the Philosophy of Psychology. In: Edition of works Vol. 7. Frankfurt am M. (Suhrkamp) 1984.
Ders. : Philosophical Investigations. In: Edition of works Vol. 1. Frankfurt am Main (Suhrkamp) 2006.
Ders. : About certainty. In: Edition of works Vol. 8. Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1984.
Ders. : Miscellaneous remarks. In: Edition of works Vol. 8. Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1984.
Zittel, Claus: Dialogue as a philosophical form in Nietzsche. In: Nietzsche studies 45 (2016), PP. 81-112.
Footnotes
1: Götzen-Dämmerung, The problem of Socrates, 7.
3: abatement 1887, 9 [35] /KGW IX 6, W II 1, 115. Editor's note: Werner Stegmaier cites Nietzsche's late estate in accordance with the IX division of the begun by Giorgio Colli and Mazzino Montinari Complete critical edition. In this, over many years of detailed work, the handwritten estate from 1885 to 1889 was reviewed once again and tried to publish it as precisely as Nietzsche actually put it on paper, with as much as possible dispensing with all editorial interventions. It was not until 2022 that the work Collis and Montinaris was (for now) completed with the publication of the last volume in this department.
4: On the genealogy of morality, III, 24.
5: Götzen-Dämmerung, Sayings and arrows, 26.
6: Cf. Stegmaier, Nietzsche at work, P. 223-234.
7: Cf. Stegmaier, Aspects of Reception and Impact [Nietzsche]: Philosophy.
8: Cf. Stegmaier, Sein zum Tode — Leben mit dem Tod And that's it: Nihilism and other beginnings.
9: With Heidegger I stick to his Black booklets, in which, as in Nietzsche's estate, it becomes apparent how he is advancing his philosophizing step by step or being driven forward by him. Wittgenstein's entire late work consists largely of individual “remarks,” which he constantly reworks, compiles and enriches, but does not publish. He too only gradually realizes what his philosophizing is about and which techniques are used to make sure of him. See Stegmaier, Wittgenstein's orientation. (Editor's note: The Black booklets, Heidegger's thought diaries from 1931 to 1975, which have been published gradually since 2014, have been received by the general public primarily because of the political statements they contain, in particular some anti-Semitic passages. However, these only make up a fraction of the records.)
10: Cf. Socrates and the Tragedy, presentation 1.
11: Cf. About the future of our educational institutions, presentation 2.
13: Cf. The happy science, Aph 31.
14: Cf. The happy science, Aph 101.
15: abatement 1887, 10 [2] /KGW IX 6, W II 2, 141.
16: Cf. Human, all-too-human, Vol. 1, Aph. 196.
17: Wittgenstein, Miscellaneous remarks, P. 541 (1947).
18: Heidegger, Notes I-IV (Black Notebooks 1942-1948), pp. 71, 76-81, 118 & more.
19: Cf. Stegmaier, The “magic of extremes” in philosophical reorientations.
20: Cf. The happy science, Aph 373: “It follows from the laws of ranking that scholars, insofar as they belong to the intellectual middle class, the actual big Don't even have problems and question marks in sight: in addition, their courage and also their gaze are not enough until then.”
21: Cf. Ecce homo, Why I'm so wise, 6.
22: Cf. Stegmaier, Philosophy of orientation. Editor's note: If you would like to learn more about Stegmaier's own philosophy of orientation, which he applies here as an example, we also recommend reading the interview we conducted with the emeritus from the University of Greifswald a few months ago (link).
23: Beyond good and evil, Aph 1.
24: See ibid.
25: Cf. Beyond good and evil, Aph 4.
26: Cf. Beyond good and evil, Aph 27.
27:Cf. The happy science, Aph 276.
28: Cf. Being and time, § 6.
29: The happy science, Aph 372.
30: Heidegger, Posts (from event), P. 69, 169, 379 & 408.
31: Cf. Jacques Derrida, force of law. The “mystical cause of authority”.
32: The happy science, Preface, 2.
33: Cf. Beyond good and evil, Aph 36.
34: Cf. Stegmaier, What does the deep midnight say?
35: Wittgenstein, Philosophy Investigations, No. 89.
36: Wittgenstein, Remarks on the basics of mathematics, I 74, P. 65.
37: Wittgenstein, Philosophy Investigations, No. 583; cf. also No. 594.
38: Ibid., No. 308. Cf. Stegmaier, Wittgenstein's orientation, PP. 45-68.
39: Editor's note: In medieval scholasticism, the Latin formula “genus proximum et differentia specifica” referred to the basic rule of every definition of the term established by Aristotle. It must always consist of a reference to the “next higher general genre” and to a “particular difference.” For example, you could call Nietzsche “that philosopher (Genus), which So Zarathustra spoke wrote (Differentia)” or define winter as “that season (Genus), which is the coldest in the northern hemisphere (Differentia)”.
40: Human, all-too-human Vol. 2, Mixed opinions and sayings, Aph 5.
41: abatement 1888, 14 [25] /KGW IX 8, W II 5, 178.
42: abatement 1886, 5 [71] (dated “Lenzer Heide, June 10, 1887”)/KGW IX 3, N VII 3, 13-24. cf. Stegmaier, Nietzsche at work, P. 319-358.
43: abatement 1887, 10 [94] /KGW IX 6, W II 2, 72.
44: abatement 1886, 5 [71], 3 /KGW IX 3, N VII 3, 15.
45: Beyond good and evil, Aph 36.
46: Cf. Enrico Müller, The pathos of Zarathustras.
47: abatement 1886 5 [71], 15 /KGW IX 3, N VII 3, 24.
48: abatement 1888, 14 [61] /KGW IX 8, W II 5, 152.
49: Wittgenstein, Remarks about the colors, I 15, P. 16.
50:Miscellaneous remarks, P. 557 (1948).
51: Heidegger, Notes I-IV , P. 64.
52: Ecce homo, Why I'm so wise, 7.
53:Beyond good and evil, Aph 27. Cf. Stegmaier, Nietzsche at work, P. 67-83.
54:The happy science, Aph 354.
55: On the genealogy of morality, III, 12.
56: The happy science, Aph 345.
57: On the genealogy of morality, II, 12.
58: Cf. Wittgenstein, Remarks on the Philosophy of Psychology, I 243—246, P. 385.
59: Cf. Stegmaier, Friedrich Nietzsche on the introduction, pp. 98-113 and Claus Zittel, Dialogue as a philosophical form in Nietzsche.
60: Their specific details have still been researched far too little. Uwe Rauschelbach also limits his expert work The singing soul largely based on theoretical considerations.
61:Götzen-Dämmerung, What I owe to the old, 1.
62: Human, all-too-human Vol. 2, The Wanderer and His Shadow, Aph 145.
63:The happy science, Aph 381.
64:Philosophical Investigations, preface.
65: Wittgenstein, About certainty, 96-99 (1949-1951), p. 140. cf. Stegmaier, Wittgenstein's orientation, P. 199-205.
66: Wittgenstein, Miscellaneous remarks, P. 476 (1931).
67: For his second major work, which will only be published posthumously posts, Heidegger chose the form he used in the compilation The will to power from Nietzsche's estate, in which everything seemed to push towards the system. Cf. Stegmaier, Forms of philosophical writings for introduction, PP. 225-234.
68: Editor's note: We know about Socrates's thinking almost only through its presentation in the dialogues of his student Plato, who here presents us not necessarily with the 'Socratic Socrates, 'but his own interpretation of his teachings.
69: Editor's note: The “HwPh” was published from 1971 to 2007 by Joachim Ritter, Karlfried Gründer and Gottfried Gabriel and published by Schwabe Verlag (Basel). The thirteen volumes are regarded as a standard reference work for philosophical research and concisely describe the historical development of the 3,670 most important terms in the history of Western philosophy. It is also available online (link).
70:abatement 1888, 18 [6] /KGW IX 12, MP XVI, 56v.
71: The happy science, Aph 306.
73: Stegmaier, Wittgenstein's orientation, P. 170-179.
74: Heidegger, Notes I-IV, P. 32.
75: Philosophical Investigations, No. 110.
76: Heidegger, posts, p. 403, 405 & 411. On the significance of Hölderlin for Heidegger's thinking, see Katharina U. Kaiser, Discussion with Hölderlin I, about his role in the “Schwarze Hefte” Rosa Maria Marafioti, Heidegger's “Schwarze Hefte”, p. 150 f. & more often.
77: Heidegger, posts, PP. 405-415.
78: Beyond good and evil, Aph 295. Cf. Stegmaier, Philosophize like a god? — Under the name of Dionysus, Nietzsche wanted to dedicate his own work to his “attempt at a divine way of philosophizing”: abatement 1885, 34 [182] /KSA IX 1, N VII 1, 68.
79: Andreas Urs Sommer (Comment on Beyond Good and Evil, pp. 804-807) takes the passage from Plato Symposium (203e-204a) in the translation by Franz Susemihl used by Nietzsche, according to which “none of the gods philosophizes or desires to become wise, for they already are, even if anyone else is wise, he philosophizes. ”
80: Beyond good and evil, Aph 56. Editor's note: The Latin phrase “circulus vitiosus deus” literally means “the faulty circle of God” or also “the vicious circle as God.” The French philosopher Pierre Klossowski used it in the title of his most important monograph on Nietzsche, Nietzsche et le Cercle Vicieux (1969; cf. also Henry Holland's article “Peace with Islam? “on this blog.)
Nietzsche's Techniques of Philosophizing
With Side Views of Wittgenstein and Heidegger
An integral part of the annual meeting of the Nietzsche Society is the “Lectio Nietzscheana Naumburgensis”, at which a particularly deserving researcher once again talks in detail about the topic of the congress on the last day and concludes succinctly. Last time, this special honor was bestowed on Werner Stegmaier, the long-time editor of the important trade journal Nietzsche studies and author of numerous groundbreaking monographs on Nietzsche's philosophy. The theme of the conference, which took place from 16 to 19 October, was “Nietzsche's Technologies” (Emma Schunack reported).
Thankfully, Werner Stegmaier allowed us to publish this presentation in full length. In it, he addresses the topic of the Congress from an unexpected perspective. This is not about what is commonly understood as “technologies” — machines, cyborgs, or automata — but about Nietzsche's thinking and rhetorical techniques. What methods did Nietzsche use to write in such a way that his work to this day not only convinces but also inspires new generations of readers? And what is to be said of them? He compares Nietzsche's techniques with those of two other important modernist thinkers, Martin Heidegger (1889-1976) and Ludwig Wittgenstein (1889-1951). In his opinion, all three philosophers say goodbye to the classical techniques of conceptual philosophizing founded in antiquity and explore radically new ones in order to try out a new form of philosophizing in the age of “nihilism.” A monotonous, metaphysical understanding of rationality is replaced by plural, perspective thinking, which must necessarily use completely different techniques. The article creates a fundamentally new framework for understanding Nietzsche's thinking and philosophical context.
Being a Father with Nietzsche
A Conversation between Henry Holland and Paul Stephan
Being a Father with Nietzsche
A Conversation between Henry Holland and Paul Stephan


Nietzsche certainly did not have any children and is also not particularly friendly about the subject of fatherhood in his work. For him, the free spirit is a childless man; raising children is the task of women. At the same time, he repeatedly uses the child as a metaphor for the liberated spirit, as an anticipation of the Übermensch. Is he perhaps able to inspire today's fathers after all? And can you be a father and a Nietzschean at the same time? Henry Holland and Paul Stephan, both fathers, discussed this question.
We also published the complete, unabridged discussion on the Halcyonic Association for Radical Philosophy YouTube channel (Part 1, part 2).

I. We as Fathers
Paul Stephan: How can you be a father with Nietzsche? Does studying his philosophy help you be a better father — or not? We want to discuss this topic in a completely open-ended manner below. But perhaps we should first clarify what, apart from the fact that we are Nietzsche researchers, qualifies us to talk about it in the first place. In fact, we will also start from our personal experiences, as we are both fathers too. Henry, you're the one of us who's a “more dad,” so to speak. How many children do you have and what is the personal background from which you look at this topic?
Henry Holland: I am the father of four children who are now between six and 23 years old. That means I first became a father when I was 26. All of these four children come from the same wife, my wife Rebecca, which can of course be completely different these days. There are two boys and two girls. It is also perhaps a bit unusual that we had actually already completed the life phase of having children and raising small children when Rebecca became pregnant again in 2018 and our youngest son Louis was born in 2019. The fact that Rebecca became a mother again shortly before her 42nd birthday is not so unusual these days — it was completely different in Nietzsche's time. But it was still a very nice surprise for us. — But what about you, Paul?
PS: I have to stress first that we will be recording this conversation on October 30 and will only publish it shortly before Christmas. Well, I have a son, Jonathan — he is now three but will be four on November 18th — and I am very excited right now and the topic of “fatherhood” is of great concern to me personally right now because my partner Luise is currently pregnant with our second child. It's still on the way now, but when we publish the conversation, it might be that time already.1 What we already know is that it will be a daughter, which actually makes me very happy. I wouldn't have a problem being the father of two sons either, I would love that too, but at least I imagine it to be another experience raising a girl.
HH: Yes, I can understand that and I was very happy back then that the first child was a girl. This may sound like an essentialist point of view, but when viewed from a constructivist perspective, it means that the children grow up necessarily influenced by existing gender roles — you simply cannot deny that, even if you want it to be different. I myself have tried to provide my daughters with all the freedoms and playrooms that I would have given to a boy — but I still notice in my own milieu: The more 'difficult' children are mostly boys, those who are more likely to stand out or rebel, who do not want to adapt socially, who rebel in the classroom. Even though many of us would like to free ourselves from existing gender norms, it can be assumed that these roles have and will have a long aftermath. Nietzsche articulates this perfectly in the Happy science:
After Buddha died, people continued to show their shadow in a cave—a tremendous dreadful shadow. God is dead: but the way people are, there may be caves in which you show your shadow for thousands of years to come. — And we — we must also conquer his shadow!2
PS: I would like to build on that, even if it takes us away from our actual topic. For me, an important aspect of being a father is that, as a father, you suddenly get to know a lot of other parents who have children of the same age as your own child. And in doing so, you can really make numerous surprising observations and findings. Although, of course, what you already said applies here: We cannot speak for “the fathers themselves.” We are starting from a specific milieu to which we both belong, a middle class intellectual milieu that primarily includes cultural workers and academics. And in this milieu, there is a fairly homogenous view that great care must be taken to educate children as “gender-sensitive” as possible, i.e., whenever possible, one should not make much difference between daughters and sons. I too think this development is generally very good and have set out to do so — but it was precisely against this background that I found it very interesting to observe that even very small children of one or two years, who are therefore still very “naughty”, are uninfluenced and are also brought up by parents who are very careful not to follow any stereotypes, often behave very stereotypically. Just one example: When my son was very young, around 1½, I went to early musical education with him once a week. That was very nice. It was a group of about six, seven children, boys and girls. It was really quite obvious that it was always the boys who roamed around the room, who tried to go outside and discover the room, who were rather loud and made 'nonsense' or even disturbed from an adult's point of view, that is, wild, while the girls were almost always sitting with their parent and were more 'too quiet, 'as opposed to that, insecure and shy.
I could give many such examples now. And of course I also know little girls in my circle of acquaintances who are very 'wild. ' But my average observation is really that you can notice all these cliché differences at a remarkably early stage — even with children whose parents are very 'gender-sensitive. ' This experience has led me to the conclusion that there is perhaps a greater influence of biology, genes, than you often think and claim. Of course, this is difficult to differentiate from the role of the unconscious character you were talking about. You will never be able to clearly differentiate between them and I don't even want to start the basic discussion of 'Nature vs. Culture' here — but the experiences mentioned have given me a somewhat differentiated opinion.

II. Nietzsche's Problematic Understanding of Man and “Woman”
HH: Perhaps this is a good reason to talk about Nietzsche and certainly the worst side of Nietzsche in terms of parenting, motherhood, fatherhood. We could perhaps work our way from his worst to his more witty and interesting statements. It must be emphasized that Nietzsche is hitting the table in some places with biological statements, for example when he writes: “Everything about woman is a puzzle, and everything about woman has a solution: it is called pregnancy.”3. This sentence is really one of Nietzsche's ten worst statements. It really seems — especially when you look at these sentences in isolation, which you shouldn't do — as though for Nietzsche, women are only there to become pregnant and serve the general good through this biological reproduction. And the women who don't do that should just shut up.4 Well, it's a very misogynistic statement. With regard to parenting, how do you deal with this very biological side of Nietzsche?
PS: Yes, I see this page the same way you do. It shows once again the big difference that separates us from Nietzsche. And there are countless places where he accordingly repeatedly expresses the clear view that women should be primarily responsible for raising children and having children, but men should, as is also the case in the passage you quoted from the Zarathustra means being a “warrior” and not worrying about the household and the children. In one sentence: “That is how I want man and woman: warworthy one, childbearing the other”5. And that may lead us to the actual main point of this conversation: Isn't it actually a contradiction to be a Nietzschean and a father in some way? Does Nietzsche even have anything to say to us fathers in the 21st century, who see us in a very different way? I think it is true for both of us and for most members of our milieu that we have a completely different understanding of fatherhood, as no one in the late nineteenth century has ever held: that you actually share the tasks of caring more or less with your mother, even when it comes to the very young children. These are things that might have been completely unthinkable even 30 or 40 years ago, which are perhaps not as widespread in other milieus even today, but which have already become very self-evident in our milieu. If Nietzsche could hear this development, he would probably, to say the least, put his hands over the head and diagnose the final “fall of the West,” the complete “feminization” and “softening.”6 The men, the final triumph of resentment-driven “general Ugliness Europe's”7. Do you feel the same way, Henry?

III. Paternity and Authenticity
HH: It seems to me that we can do that after all, that we can be Nietzscheans and yet be progressive parents in the 21st century. In this regard, I would actually come back to the concept of authenticity again and again — it just comes up again and again. You are much more familiar with this than I am, after all, you have just written and submitted an entire doctoral thesis on this topic. Authenticity is a very central concept for Nietzsche and I believe that what children are looking for primarily in us parents, both in fathers and in mothers, is authenticity. With fathers, however, in a slightly different form, because they tend to be more absent from the relationship and because the child expects this parent to remain authentic. And that means: Not only is static, but strives for authenticity, certainly in the spirit of Nietzsche's idea of selfBecoming as a creative, inexhaustible process of self-creation.
I'll try to make this concrete based on my eldest daughter, Alma. So she clearly shares my left-wing political views with me, which definitely expects, perhaps even as a basic condition, that I do not express myself in a gender-discriminatory or otherwise discriminatory way — and I actually am not, I don't do that. But that is not their main expectation of me that, to put it somewhat flatly, I always express myself 'politically correct', but that I remain authentic in my nature, in my actions, even outside the family, and that this authenticity can be retrieved and verified in some way.
Perhaps to make it even clearer and to build a bridge with my own father, who is still alive: He grew up in the final phase of British imperialism, when there were completely different values. One of the main values was this idea of “service.” You stand, you live life in service The other person — that's what you're there for. So you're there as a family man to earn money by doing a decent job in your outer life. The “self” doesn't come into conversation that much. So there is a certain class of British men, the very last thing they would talk about would be themselves. You hardly talk about it, it's more about this service principle. As a young man and as a young father, I often asked myself: What is my father's authentic self behind this existence in the service of others? What is its authentic core? And that often left me with nothing but a question mark, which is remarkable.
PS: Yes, it's very interesting and we seem to have had a very similar experience there. We came to the point shortly after during the preliminary discussion that it has become very difficult these days to gain an authentic understanding of one's own paternity, because the existing role models, which you could use to orient and work through in your own self-design, have become very fluid. It used to be very clear: The father is the one who earns the money. For example, there is this television series Breaking Bad, where this happens several times: “A man provides,” “a man provides,” even if those he provides don't even respect or love him. He doesn't care much about the kids at all. We are trying today to develop a different understanding of a present and caring, loving father.8
It was now very similar to yours with my father. Perhaps that is also the reason why I am so interested in the topic of 'authenticity. ' You have to know that my father grew up in the GDR. There is this catchphrase of “homo sovieticus”, which the Soviet philosopher and dissident Alexander Zinoviev coined in the 80s to describe the extremely adapted type of person that was called for and promoted in the states of the “socialist world.” As a hyper-opportunistic implementation of Nietzsche's dystopia of the “last person,” who imagines himself at the end of the story; a person without an inner center, who doesn't even strive for authenticity, but is completely absorbed in service to the community.9 I believe that this concept can also be applied to the GDR. Education in the GDR was even more strongly focused on the ideal of “service” than in the West; I think this keyword is very good. You shouldn't start from yourself; there were certain social expectations and you should meet them. I have always perceived my father, who is still alive, as a very inauthentic person. He is still a mystery to me in many ways, he is a very ironic person who hardly ever talks about his feelings and what is actually bothering him. You get the impression that he just doesn't have a good relationship with himself, and I noticed that even as a child and led me, I think, to try to become another man, another father. In this respect, my father actually served as a negative example for me, even though I don't want to blame him for anything. Especially when I was a little boy, he was also a very good father and took care of a lot. But I also felt this deficit, this distance from him, very early on.
And yes, there is indeed a close connection between these topics of “authenticity” and “fatherhood.” In any case, it appears often in my doctoral thesis, more often than I would have thought possible at the beginning of my research paper. But that may lead us to a slightly different understanding of masculinity. As already indicated, there is, on the one hand, this understanding of the man as a servant who sacrifices himself for the community, as Hegel articulated, for example, but then also the understanding of man as someone who completely stubbornly only thinks of himself, who places his own self-realization above everything else. And that is precisely the idea of masculinity that you actually find in Nietzsche, and around which his entire understanding of authenticity revolves — which, in my opinion, represents a huge problem. Just look at the following passage from the genealogy:
In this way, the philosopher perhorres [rejects with disgust] the wedlock Collect what would like to persuade her — marriage as an obstacle and disaster on his way to the optimum. Which great philosopher has been married so far? Heraclitus, Plato, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Schopenhauer — it wasn't them; what's more, you can't even look at them think As if married. A married philosopher belongs into comedy, that is my sentence: and that exception is Socrates, the spiteful Socrates, it seems, married himself, specifically at just this sentence to demonstrate. Every philosopher would speak as Buddha once said when the birth of a son was reported to him: “Râhula was born to me, a shackle is forged for me” (Râhula means “a little demon” here); every “free spirit” would have to have a thoughtful hour, given that he had previously had a thoughtless one, as it once came to the same Buddha — “closely pressed, he thought to himself, is that Life in the house, a place of uncleanliness; freedom is in leaving the house”: “Since he thought so, he left the house.” In ascetic ideal, there are so many bridges to independence indicated that a philosopher cannot hear the story of all those determined people who one day said no to all lack of freedom and in some desert Giengen: Assume that they were only strong donkeys and completely the counterpart of a strong spirit. So what does the ascetic ideal mean for a philosopher? My answer is — it will have been guessed long ago: the philosopher smiles at the sight of an optimum of the conditions of the highest and boldest spirituality, — he says no not Therefore “existence”, he rather affirms it being Existence and only his existence, and perhaps to the extent that the wicked wish does not abide by him: Pereat Mundus, Fiat Philosophia, Fiat Philosophus, Fiam! ...10
The following therefore applies: Even if the world were to end, philosophy should live, the philosopher should live, I should live. I think this quote contains a great deal of Nietzsche's understanding of freedom and authenticity, which is simply not compatible with fatherhood. The son is only described here as a “little demon” — and there are many such passages from which it is clear that Nietzsche, who was also known not to be a father himself, does not want to know anything about it. He believes that being a father is completely incompatible with philosophical, but also authentic, existence.

IV. Philosophers as Fathers — a Good Idea?
HH: Yes, that is an interesting passage. Although Nietzsche's thesis is, from an empirical point of view, contestable. Hegel had about two legitimate sons and another illegitimate son,11 Marx even had seven children with his wife Jenny, three of whom reached adulthood.12 — Although it is disputed whether Marx was also a good father.
PS: I would like to protect Nietzsche a bit there. It is remarkable that there are so many philosophers who have remained childless, lived partly as bachelors, and in some cases may have had a child.13 Well, you and your four children are definitely noticeable, I would say. Even more these days. But in the 18th/19th century, it was more the rule that you had five or six children, very large families — and philosophers were usually more of an exception. That this is the case has of course also to do with the image that the man should be the provider of the family and of course — as is still the case today, but it wasn't very different back then — it is often very difficult for philosophers to fulfill this duty.
HH: Although I wouldn't describe myself as a philosopher at all, but as someone who is interested in and works with philosophy! — In any case, my answer to this Nietzsche passage would be, in order to approach it a bit more economically and neutrally, that if he had lived in a middle-class household with marriage and children, he simply could not have written. His writing style, the writing process, his texts would have changed. This way of working, which was characterized by very short periods of productivity lasting nights and days, and then long phases in which Nietzsche suffered so severely from his symptoms of illness that he could put absolutely nothing on paper — it was impossible for a father to pull off this' ecology 'in a halfway' normal 'environment. The opposite is the case with the family fathers Hegel and Marx, whose main works came about much more slowly and are therefore much more saturated, have a completely different form and stringency.
Referring to Nietzsche's claim that so many great philosophers remained unmarried, I would simply like to ask the classic Marxist question: Who then did the reproductive work? So not only in terms of having children and raising children, but also: Who cooked lunch? Who cleaned? Who did the laundry? And the answer to this question, even in the case of Nietzsche, will surprise no one: 95% of them were women, mostly unnamed. I am thinking, for example, of Alwine Freytag, the long-time servant in the mother's household, who helped to care for Nietzsche in his last years — who knows her? There are always several people who did all this reproductive work in the background so that the “great philosopher” could write his works.
This may be self-evident to some, but it is often lost in the history of philosophy. And that, I think, is also the reason why we may no longer see works such as Nietzsche's. There is simply no woman or man, no one who could afford such a lifestyle anymore — I don't mean that purely economically, but from the point of view of what you feel responsible for yourself and what you don't.
PS: Yes, Nietzsche was completely dependent on the care of women for many years, as a child anyway and then again when he had mentally changed his mind. I recently attended the last annual meeting of the Nietzsche Society14 A very interesting and entertaining presentation was given by Ralf Eichberg about Nietzsche's failed plan to buy a portable oven. Based on the correspondence between his mother and him, it became very clear that, however, it was also a problem for the reindeer Nietzsche that he could not really afford servants but simply could not cook at the same time — much to his mother's concern. So his position wasn't that privileged — but in principle I agree with you, of course. It is true in general that philosophical work for centuries has largely been based on the work of women in the background, whether as servants, but also as secretaries or even unnamed co-authors.
When it comes to today's philosophy, that is of course the question: Is it progress or perhaps also a step backwards? Yes, Nietzsche's extravagant writing style has something to do with the almost stereotypical masculinity that he not only propagates in his works, but which this style also performs himself. But it is just an immature, puree masculinity. In the speech From old and young women, which, as already quoted, actually shows that women should not only have and educate children, their task is more comprehensive:
The man should be brought up for war and the woman for the warrior's recovery: everything else is foolishness.
Too sweet fruits — the warrior doesn't like them. That is why he likes the woman; bitter is even the sweetest woman.
The woman understands the children better than a man, but the man is more childlike than the woman.
There is a child hidden in ostracized man: he wants to play. Come on, women, and discover the child in the man for me!
A toy is the woman [.]
So in Nietzsche's imagination, the man remains a child all his life and should not grow up at all. And of course: This childishness, this immaturity that you retain, can, as in the case of Nietzsche and in many other cases, release great creative potential. But I do think that it is not bad for philosophy to start from a somewhat more mature and responsible attitude, as a father must automatically display and develop. I would also say the same for my own thinking, for my own philosophical, intellectual work. So becoming a father is of course a loss, not only a loss of time, quantitatively speaking, but also a loss of concentration in terms of quality. You can no longer write through for nights if you are woken up by a child every morning or have to take them to daycare. You are pushed more and more into a responsible and caring position, which, however, is not necessarily a hindrance to thinking, but rather leads to a deepening of thinking, which in particular involves thinking less strongly about yourself, but really engaging in this relationship with the other being — and I actually see this as a great asset both for myself as a person and for myself as an intellectual. It is simply not true, as Nietzsche mantraically asserts, that a “great culture” can only be created in such a way that a small caste of “masters” is unconcerned about the little things in life on the backs of millions of “slaves” and above all “slave”inside“live out — this leads to a castrated culture, this leads to exactly that decadence and alienation of life that Nietzsche so verbally warns about; and knows exactly that he himself is: A typical Decadent, the tragicomic result of a recent flourishing of a culture that was already in decline in its time and was based on exploitation and separation. The way out of cultural decadence can only lie in a non-decadent lifestyle — into production and even reproduction; overcoming the separation of head and manual work — but Nietzsche was only able to glimpse such an option when he jealously looks at the “birthing” ability of women and elevates it to a metaphor of authentic creative creation. As a caring father, he would also have been able to participate in this on a completely non-metaphorical level. — Although I don't want this to be understood as moral criticism, after all, it would hardly have been possible for Nietzsche to live another life in view of his illness.

V. Nietzsche's Personal Experiences
HH: Yes, I would like to take up this keyword of 'thinking about relationships with other people. ' Although I find it difficult to describe Nietzsche's style and attitude as 'immature. ' This is indeed a challenge, because if you didn't have this' halfway 'and' immaturity ', it wouldn't be Nietzsche again, his work would not have the authenticity that makes it so unique. It really is Nietzsches work.
But back to thinking in and about relationships. This deeper thinking in and about relationships with other people or about society, about political forms — I would say, for example, that Hegel has more to say than Nietzsche when it comes to the relationship between the individual and the state, which, I believe, remains an important philosophical issue. Nietzsche is on a genuine Societal thinking Not interested at all, that is not his topic.
As you have already indicated: Nietzsche has just, in line with his teaching of Amor Fati, made a virtue out of necessity. Nietzsche had a very difficult time in human relationships. He hardly cultivated those that could be described as “normal” in any sense, especially if they had any sexual component. This is perhaps most clearly shown by his brief friendship with Lou Salomé. He may simply have lost the ability to have long-lasting relationships, especially romantic and especially erotic ones — and he succeeds in creating an entire philosophy out of this coincidence. This conversion of philosophical coincidences into philosophers seems to me to be a general characteristic of Nietzsche's work. Why not? But that naturally raises the question of what other people can make of it.
Against this background, perhaps we should also talk about Nietzsche's own relationship with his father. That seems to me to be very central to our topic. He died when Nietzsche was five years old, so really early. However, this relationship was quite intense. Little Nietzsche was the only one who was allowed to stay in his father's study while he, a Protestant pastor, wrote his sermons and took care of the written community work. Perhaps because, unlike many other small children, he was very quiet and did not disturb so much. Although that is also noticeable. There are few signs that little Nietzsche played a lot with other toddlers and let off steam. Nowadays, his father might have taken him to the therapist earlier — and the early death of his beloved father has certainly reinforced this unusual tendency in little “Friedrich.”
There is a quote that is very relevant to our topic, about abandonment by one's own father, about his absence and about how much this experience shaped early Nietzsche. It is a childhood memory of Nietzsche, which he wrote down shortly before his 14th birthday, in one of the remarkably numerous autobiographical writings from his youth. It is about the time after the death of his father and the death of his little brother Ludwig Joseph shortly after:
At that time, I once dreamt that I heard organ sound in church just like at a funeral. Since I saw what the cause was, a grave suddenly rose and my father in death-dress emerges from it. He hurries to church and returns shortly with a small child in his arms. The burial mound opens, it climbs in and the ceiling sinks back onto the opening. The rushing organ sound is immediately silent and I wake up. — The day after that night Josephchen suddenly becomes unwell, gets the cramps and dies within a few hours. Our pain was tremendous. My dream was completely fulfilled. The small corpse was also placed in the father's arms.15
Of course, you can't know whether this is a real memory and how much Nietzsche poetically added to it as a teenager in view of his lyrical tendency. But there is still a memory that is about being abandoned and farewell — and it raises the question for me how much Nietzsche has brought to a philosophy that revolves very much around the “strong individual,” in which it is made a virtue that you isolate yourself, that you should not rely on the other person, that as a man you should not marry and not have children. And this seems to me to be diametrically opposed to our understanding of fatherhood, which is primarily about being there for the child, being there for conversations, playing actively with the child, i.e. creating an active relationship with the child.
PS: Yes, the absence of his father is mentioned in almost all biographical texts on Nietzsche as an essential factor in his personal development and I completely agree with that. Perhaps there is in fact also, unconsciously, repressed, a lot of disappointment and anger, spoken with Nietzsche himself: resentment, towards the father. Because as a child, you may experience such an event not so much as a stroke of fate, but as if the deceased parent had deliberately abandoned you. You have to struggle with this experience all your life. And even in the case of Nietzsche, that may be a decisive reason why, it must be said so clearly, he really generally fails in interpersonal relationships.
So what I would also like to emphasize very clearly at this point: I am of course not of the opinion that you absolutely have to become a father in order to enter into a caring, responsible relationship with others as a man; there are of course many other ways of realizing this. Fatherhood is one of them, a romantic relationship of two too, of course, there are many options. But you can certainly say that Nietzsche has generally failed in this regard. So there is no example almost in his life of a really successful interpersonal relationship over a longer period of time at eye level — which is of course absolutely sad, but should also shed some light on his thinking.
And then there is also this somewhat funny story with Lou Salomé. It makes sense to counter Nietzsche: He says that the married philosopher belongs in comedy — but the philosopher, who has had a large number of failed marriage proposals behind him, belongs there much more. In any case, he certainly wanted it for a while. However, you also have to see that letters repeatedly show that he wanted to marry primarily for pragmatic reasons in order to be better provided for materially — or even to have a “free nurse” or assistant, so to speak. Although this is certainly something else in the case of Lou Salomé, he certainly saw her as an exchange partner at eye level and probably also as a romantic-erotic object of desire in some form — although I don't want to address the topic of Nietzsche's exact sexual orientation at all, especially since it has already been discussed extensively on our blog anyway.16 But the pragmatism, sometimes downright cynicism, when it comes to marriage, which he sometimes allows to shine through in his letters, certainly doesn't exactly speak for him.17
But, as always with Nietzsche, there is also a passage in the work on this subject where he represents exactly the opposite. I have found at least one from his middle creative phase, a short note from the estate of 1881, which states:
Having descendants — that is what makes people stable, cohesive and able to do without: it is the best education. It is always the parents who are brought up by the children, and by the children in every sense, even in the most spiritual sense. It is our works and students that give the ship of our life the compass and direction.18
Unless I've overlooked anything, this passage hasn't made it into the published work either, but I think it's really great. It is also much more in line with my own position than the almost somewhat creepy passage from the genealogy, from which I quoted above. The fact that children also “educate the educator,” that education must generally be understood as an interplay, as a maturing process in which parents also mature first — I think that is a very clever idea. From my own experience, I can definitely confirm that this is the case, and I would therefore say that it would have been very good for Nietzsche to be able to take this further step of education. As I said: That is not a moral criticism, it was rather his fate and he certainly understood how to make the best of this fate and then he just ex post thinks of a philosophical justification for this. Just like most philosophers.
I see two possible scenarios. One day, that Nietzsche as a father would have stopped dealing with philosophical topics and really only cared about “providing” — or that he would have continued his philosophy anyway and perhaps even better books would have come out if he had succeeded in, this childish narcissistic aspect, which he definitely has very strong, and a somewhat more responsible view of society, of the big picture, in which you as a Father is almost brought up to bring together. Perhaps then he would really have become the greatest philosopher of the 19th century. It's possible, isn't it?
HH: Yes, it is possible and I really like this mind game. Although I would of course prefer the second option. If he had found someone on equal footing, if he had succeeded, he would certainly have created a very different work, perhaps a much more mature work.
What else I find important to mention at this point: What were Nietzsche's encounters as an adult with small children? There aren't many, all notable meetings took place in the Wagners' household, from 1869, when Nietzsche had just taken up his professorship in Basel and was regularly invited to the Wagners' country estate in nearby Tribschen. At this point, Cosima was still married to her first husband Hans von Bülow, but Richard Wagner and she had already been in a relationship since 1864 and had lived together since 1867, had even begun founding a joint family with two daughters, Isolde (born 1865) and Eva (born 1867). In May 1869, Nietzsche visited Tribschen for the first time and Siegfried, the couple's third child, was born as early as June. And this is where it gets interesting: The biographer Sue Prideaux19 Does it actually mean that Nietzsche was so far removed from life in everyday life that he almost did not notice that Cosima was pregnant when he visited the Wagners in May — which would have been a piece of art, in fact it couldn't have been the case at all. And it was even the case that Nietzsche was there the night Siegfried was born, and he simply did not even notice it, not even the screams that certainly accompanied it. He only realized the birth at breakfast, when the new person present could no longer be overlooked. — That's the version of the events, as Prideaux tells them, anyway. And even though that may be an exaggeration, this anecdote very well reflects something of Nietzsche's great alienation from the world.
PS: Yes, he was certainly not the most emphatic person, always lived something in his own world, you can imagine that very well.
HH: Although Cosima and especially Richard later played seriously with the idea that Nietzsche should take on a kind of teaching role for Siegfried. In 1872, Wagner uttered such simulation games to Nietzsche in two letters, going so far as to bring Nietzsche into the game as a kind of substitute father for “Fidi” — and accordingly Nietzsche himself as Wagner's surrogate son.20 However, Nietzsche showed no interest in this, because both times he simply ignored the request of his “beloved master,” as he still called Wagner during this time.21 So it seems that Nietzsche did enjoy his repeated visits to Tribschen in the midst of a household of young raging children, but that he did not find a way to further expand on this experience in his own biography.
PS: Yes, I think building such a relationship with a child would definitely have been good for Nietzsche. But you also have to see that the Wagners did not always have the best intentions towards Nietzsche. Christian Sährendt speaks in an article about the Nietzsche/Wagner relationship on our blog also from a “terribly nice family” that the young professor went to there. Perhaps this plan was also about simply exploiting Nietzsche — but perhaps he had also felt that it would have promoted Nietzsche to take on a kind of father role.
HH: I think we should start from good intentions, even though bad intentions cannot be ruled out, of course. In any case, it should be noted that there was certainly this phase in which Nietzsche, as the Wagners' 'house friend, 'had regular contact with small children — but it is unlikely that he used this opportunity to establish an intensive relationship, for example with the young Siegfried. Siegfried Wagner will hardly have noticed any kind of father figure in Nietzsche; it stuck to a mind game. — Perhaps this will take us on to address what Nietzsche wrote about childhood in general.

VI. Nietzsche's Affirmation of Childhood
PS: Yes, we should definitely talk about this topic! It is really remarkable that Nietzsche hardly ever had anything to do with real children, but is certainly one of the thinkers who said the best things about childhood and pregnancy.
The pregnancy metaphor is found primarily in So Zarathustra spoke. It has, of course, a misogynistic component in the sense that Nietzsche, as we have already discussed, starts from a strict division of the sexes in this regard and fixes both in a specific role. But it must also be said that Nietzsche also extremely values giving birth and sees it as a metaphor for the ability to create creatively. Men can also be “births” with him and have children, including Zarathustra or himself. Against this background, feminist interpreter Caroline Picart even speaks of “Nietzsche's incurable oath of childbirth [Womb Envy]”22. It is therefore in a certain sense a devaluation, but also an appreciation and there is a whole strand in the female-feminist reception of Nietzsche, in which women relate positively to this side of Nietzsche's work, starting, interestingly enough, with Lou Salomé to the important difference feminist theorist Luce Irigaray.23
But even more important for our topic is the metaphor of the child. There are numerous profound passages in Nietzsche's work here, which have inspired me time and again as a father, and which can only be explained by the fact that Nietzsche remained a “big child” throughout his life, retained a great childishness and was therefore able to write very well about childhood, even though he lacked empirical experience. To give just one of countless examples, I am thinking of this famous sentence from Beyond good and evil: “Man's maturity: that means having rediscovered the seriousness you had as a child while playing. ”24 That's a special term for “maturity,” of course, but when I watch my son playing, he shoots through my head over and over again and he already has a truth. Children are sometimes so incredibly absorbed in their games, they take them so seriously. The adult often makes fun of this and interprets this seriousness of the unimportant as childish and immature — but doesn't he also envy the child for this ability and are we adults so different when we get excited about something?
And there are also countless passages on this aspect in Zarathustra. There is, for example, a passage from the book that Swedish feminist author Ellen Key (1849-1926) also wrote her book The century of the child (1900), a classic of reform education, as the motto:
Yours Kinder Land You should love: this love is your new nobility — the undiscovered one in the farthest seas! After him, I'm looking for and searching for your sails!
On your children shall you Do wellthat you are children of your fathers: everything past shall you thus Redeem! I'm putting this new board above you!25
Interestingly enough, this could even be interpreted as a plea for fatherhood26 But it is primarily to be understood as a plea for childhood. That children's openness and creativity should almost be taken as a role model for a creative, life-affirming attitude. And there are also countless places where the playing child actually acts as a metaphor both for the creative person who is on the way to becoming superman and for the superman himself.27
Sure, that's a romanticizing understanding of childhood that, as a real father, you might not share 100% — and that's why Nietzsche knows that too28 —, but in principle, these are great sentences that should encourage us not to completely lose our own childishness even as fathers and perhaps also to learn from our children to rediscover our own childishness, that is also a side of being a father, isn't it?
HH: Yes, this impartiality or even indignity, this ability to completely lose oneself in the game, which we see especially with smaller children, is also found in many of Nietzsche's texts. I think what sets him apart from many other writers — and I tend to actually compare Nietzsche with particular writers rather than with other philosophers, I see him more and more as an artist and only as a subordinate philosopher: He often has very little self-censorship, just like small children. We experience this time and again with our six-year-old Louis, this complete openness even towards strangers in the message. On the train, for example, he meets a completely unknown person and simply starts talking about details of family life that no adult would ever tell just like that — because the vast majority of adults have internalized a certain self-censorship, we are already thinking pretty carefully about what can and cannot be said. Especially when we write, especially when it is something that goes in the direction of science, then we think even more carefully, then this self-censorship works even more strongly. I often think of George Orwell's insight that this self-censorship is even more powerful than censorship itself, i.e. what we filter out ourselves before we even submit a text.29
And that's the great thing about Nietzsche: Of course, he carefully edited his texts before they were printed, but they still seem as if he were talking straight ahead, as if he were not self-censoring, speaking completely authentically. And that can go both ways, of course — sometimes this openness makes him write terrible things, but sometimes it also leads him to real wisdom and jewels. That is almost the biggest thing we can learn from children.
And I also like this idea from the other quote that children are the educators of adults. It's a really great subject. And I don't find that romanticizing, it's already real. The challenge is simply to live this authentically in everyday life. For example, what our Louis wants to do with me often, less with my wife Rebecca, that is what he called Toy Fight, 'game fight. ' He often wants to do this right after getting up, around half past 7, even before breakfast. Above all, that means jumping on dad pretty wildly. Of course, there are a few rules of the game, so you can't scratch, don't bite, don't pull your hair and you can't hit certain sensitive areas — but apart from these four basic rules, it's relatively random, you can do more or less everything and that's another opportunity to live an uncensored self, which can contribute to the development of an authentic self. I think that is something that we, regardless of whether we are fathers and have children or not, lack in everyday life, because it is so incredibly structured and thoroughly scheduled. And digitization has also failed to bring the hoped-for liberation; rather the opposite is the case. Our time is simply becoming more and more economical; everything should be able to be planned. And I do believe that our children give us the opportunity to free ourselves from it, even if it is only for 20 minutes, to free us again and again — and that is something I would not like to miss.

VII. Once Again: Masculinity and Femininity
PS: Yes, I can only agree with that; I have a very similar experience there. Where I would like to follow up with regard to the topic of gender and gender roles: It is also interesting how children very intuitively assign different roles to parents and raise different expectations of them. It is also the case with us — and this is not possible, at least not consciously, on our part — that very different things are expected of my partner and I. From me in particular this fighting, it's almost exactly the same for us, there is always a lot of “fighting” — but Jonathan almost only wants to do that with me. Sometimes even with Louise — which of course doesn't work particularly well right now that she is heavily pregnant — but above all with me he wants to fight and do 'fighting things, 'which are more stereotypically masculine, while he is more likely to cuddle extensively with Louise, make out and do rather tender things. With him and me, on the other hand, he doesn't necessarily want to do such things and also makes me understand that — which is of course perfectly fine, even if it sometimes offends me a bit.
HH: We also have “toy fighting” just with me, Rebecca simply says “no” and doesn't feel like it — in return she does a lot of other things with Louis. You can speak of “stereotypes” here, but from a philosophical point of view, you could also call it something else. For example, you could bring the term “archetype” into play for her — but then you're moving on thin ice right away. Perhaps to put it more neutrally: Many specific behaviours remain counteracted, whether we like it or not, that is precisely our cultural heritage. A specific example: knitting. Maybe the circles I'm in are the wrong ones and not progressive enough, but I don't know a single man who knits. Of course I've seen photos of such men, but I don't know anyone. On the other hand, I know a number of women who knit — Rebecca, for example, knits very well, she makes insanely great fashionable sweaters and something like that that are almost works of art. She also taught Louis how to knit fingers; for example, he can make small scarves or something like that himself — that is a very real skill, a skill. In other words, these are skills that do not naturally belong to any gender, but which are also assigned only to one gender for cultural reasons and are passed on accordingly.
And perhaps to give another example, even though it may be a bit profane: In Great Britain, there are the “Ladybird Books”, which are small-format books for small children, comparable perhaps a bit to the German Pixi books, which have had a mass edition. So all middle class children in my generation had them, they simply had good quality and very good illustrations — but many were written in the 1950s and 1960s and therefore fall very much into gender stereotypes, both as regards girls and women as well as boys and men. It really uses all clichés. Recently, as a post-modern joke, the publishing house released something called “Ladybirds for Grown-Ups,” for adults, i.e.30 That takes this whole thing on the arm, there is something like a book that simply means The Dad. The father is stereotypically standing at the grill and there is something like — the lyrics are very short, just like in real children's books: “That's the dad. He seems complicated, but he simply lives off beer and sausages. “That's all it says. My wife Rebecca and I actually find that very funny because we know a lot of fathers who are really like that.
What I'm getting at is that this is the dichotomy in which fathers of our generation are stuck, that we still have a strong cultural and social heritage — we're talking about centuries that were very different — and have only been trying to get out of it for about 40 or 50 years, but we just can't do it right away. These simple fathers, who could not or barely show their feelings, let alone talk about them, who were somewhat simple in this regard — they remain in us as an inheritance that perhaps needs to be overcome.
PS: Yes, ten horses wouldn't get me to knit either, even though I enjoyed doing it for a while when I was around eight or nine years old. — But I wanted to say a little counterspeech at that point. Well, let's not go unmentioned, there is also no pure biologism in Nietzsche. There are, for example, in the Götzen-Dämmerung this remarkable sentence: “The man created the woman—from what? From a rib of his god — his' ideal '...”31 And there are many other such places where it is shown that Nietzsche, as a historically thinking person, is already aware that gender roles are absolutely changeable, “socially constructed,” as you would say today.32
The other thing is, as already indicated, that his statements about women are not meant to be derogatory at all. Even in From young and old women Among other things, it also says:
A toy is the woman, pure and fine, like a precious stone, irradiated by the virtues of a world that is not yet there.
May the ray of a star shine in your love! Your hope is: “May I give birth to Superman! ”
Similar to the playing child, it is not only the man as a “warrior,” but also the woman giving birth as a symbol and physical appearance of the superman and Zarathustra and even his own work are repeatedly equated with giving birth — even in this speech himself. And it should also be clear that the notorious “whip sentence” from this speech can also be interpreted in the sense of such constructivism.33 But even reading essentialistically, there are and were numerous women and feminists who have adopted this side of Nietzsche positively, affirmatively and were inspired by it in their definition of femininity.
So my position in this regard is very clear that it is a problem when there are these repressive norms, these stereotypes, and you have the pressure to adapt to them because they simply do not reflect the diversity of the human species and leave little room for deviation. It is a good process in that they are dissolving and becoming more flexible at the moment. But at the same time, you also have to see that these stereotypes are not only arbitrary, but that there is already something called a biological substrate in some form. This is of course difficult to determine; you will probably never be able to define it in its pure form. But there is evidence that this stereotypical behavior can already be observed in small children and therefore cannot be purely educated. This is a fact that, despite all criticism of repressive gender norms, cannot be ignored. It is also undeniable that certain hormones, such as testosterone in particular, have an effect on mental life. It just does something to people when they naturally have higher testosterone levels.34
You just have to be careful, and that's where Nietzsche comes into play again, that you don't replace one repressive morality with another. All people should be equal; as a man, you simply must not behave too masculine, and as a woman you must not behave too feminine. I would say: No, it's okay to live according to predetermined stereotypes. Why should you bend over there? That can certainly be an expression of authenticity.
Quite apart from biology, it also makes sense that there is this division of roles. Interestingly enough, homosexual couples are also often unable to break away from her and one partner is more likely to take on a “female” role in them and the other a more “male” role. This involves dividing up certain tasks, although care should of course be taken to design them fluidly and situationally so that both partners can develop equally.
HH: Yes, I completely agree with you that it makes no sense to replace one repressive morality with another. Although this could be seen as tricky in some circles. This whole topic of Manosphere, i.e. one Bubble On the Internet, which is about creating a new sense of 'real masculinity, 'in contrast to' wokeness' and feminism, and which is often perceived as very sexist and misogynous (and is certainly also in large parts), that has already become a very hot topic. Christian Sährendt has already addressed this topic on our blog in his article on the question of whether Nietzsche was an “Incel”. When there is talk of men and fathers in public discussion at all, it is usually about this topic of “toxic masculinity.” But what if you don't want to become or remain “toxic” — is there a public space to discuss it openly? Some have come to the interesting view that that is precisely why some men are so susceptible to this Manosphere- Get spelled because there are so few models of good, non-toxic masculinity or paternity so far. And it is also striking in this social equality debate — which must continue for good reasons — that a sub-chapter of this discourse is that both the best and poor life results in the global North are achieved by men. As a man, you are therefore more likely to be very rich or successful — but also to commit suicide, to suffer from an addiction, to die young, that you simply won't be able to eat properly, or become long-term unemployed — to name just a few of the worst life events that are particularly strongly associated with men. It's also part of being a father, managing the balancing act of being a good father without ending up with these worst results.
Or, to be more specific: Why do so many of these men and fathers vote for Donald Trump or right-wing populist parties? Of course, women also vote for him, but there are significantly more men. Not because they are all so well protected or privileged — on the contrary, it is the case that millions of them live so precariously that they are outside the social mechanisms and no longer have any confidence in making their own living conditions better; instead, they bet on a 'big throw, 'a 'Trump throw; this idea of being a 'tough man,' a toxic man, who you without any social Insurance gets through.
So it's definitely a bet on our part to publicly discuss such a topic as fatherhood at a time when public discourse about men is primarily characterized by this concept of 'toxic masculinity — I hope this bet turns out well.
PS: Yes, I also perceive that there is a vacuum, an absence of role models of non-toxic, responsible masculinity and fatherhood — which leads to great disorientation, especially among young men, and to the fact that they flock to replace wannabe “supermen” such as Trump, Musk or even Putin. The old “idols” have fallen, but no new ones have taken their place — and, paradoxically, this is leading to a frightening renaissance of such pseudo-archaic “barbaric” figures. But we emancipated men should not mourn this vacuum, in a completely Nietzschean way, nor fall into nostalgia, but as an opportunity for a new cultural start, to create a new, better understanding of masculinity and fatherhood. As fathers, we in particular are called upon not only to preach such an understanding, but above all also to live by, hopefully, to serve our sons not only as negative repulsive figures, but also as role models from which they can grow — and then of course repel ourselves from us again, that is unfortunately also part of being a father.
In essence, my point is that you should simply strive for your own, authentic understanding of fatherhood and masculinity — and, of course, of motherhood and femininity — which is independent of existing stereotypes. But it would also be inauthentic, and simply not particularly healthy, not healing for yourself, to now desperately want to free yourself from these stereotypes at any price — both in terms of your own self-image and in terms of your own educational practice. I already notice such tendencies in my environment that, for example, people want to avoid boys playing with weapons or being interested in war at all costs — and perhaps trying to force girls to do just that. And you get the boys to play with dolls. Well, this is of course an exaggeration, but there are already tendencies of this kind that I cannot approve of.
In general, I do not find this whole discourse about 'toxic masculinity unjustified. ' I think there is. By the way, there may also be a type of 'toxic womanhood, 'i.e. stereotypical female or even maternal behavior that is not particularly healing for those around them. They only appear more subtly, for example in forms of emotional manipulation and blackmail. Although, of course, the question is: What does “toxic” actually mean? Isn't that a very vague term?
So I think it's generally good that such behaviours are being questioned, both among women and men. But at the same time, I also observe a certain insight or even discrimination of typical male behavior, which is definitely At least It is hypocritical, because precisely these behaviours also have their social justification and are in many cases necessary in today's society. Even people who are very upset about typical male behavior may also be happy when there is a tough police officer who defends them in an emergency. And there is now a lot of talk about a “turning point” and rearmament — which I find problematic again for other reasons — but you just have to want both, you can't say that you have these masculine behaviors that you display as a soldier must, are very bad and problematic, but at the same time we need a lot more soldiers and at least everyone men — Why just them? Does this perhaps also have something to do with biology? — should do military service again. So I see a certain contradiction in our society and in the debates on this topic. Speaking in general terms, you should perhaps simply recognize that some of these typically male behaviours are not that bad at all and have their right, unless they are pushed to a certain extreme.
The best example is Nietzsche himself, who was perhaps in some way, if you want to use this term, a “toxic” or at least stereotypical man. We have discussed this and there is a lot to criticize about it, but this attitude in turn also enables him to create his great work. I believe that it would also have been good for the work if Nietzsche had questioned his own masculinity more — but would it really have come about without the infantile narcissism that Nietzsche cultivated?
And even with myself, I notice that, even though this is partly not my nature at all, I am being driven into such a masculine role, which I would define as having a slightly different parenting style, that in certain stressful situations, you are more likely to remain calm and make clear views. I think that is something that is simply needed, which you might then also achieve as a man must. Sure, on the one hand, I fail often enough, and secondly, there are also situations in which my partner takes on this part, but I think that this part, this perhaps slightly “authoritarian” part, is sometimes needed, and then it would perhaps be more important that you take on this male part in a non-toxic and responsible way, but also not completely reject yourself. I think that there is something very infantile about this new 'post-modern post-masculinity, 'that is to say again a' toxic 'masculinity in a different way — in Nietzsche's way. You actually remain a child, you relinquish responsibility, you no longer want to be' authoritarian 'at any price or something like that, you speak very softly, don't spread your legs when sitting... So this infantie It is linked to an extremely moral and self-negative attitude. This is once again a one-sided development, an escape from responsibility and also from authenticity, because I certainly perceive that such men are not in an authentic self-relationship, but rather artificially suppress a side of themselves that they should perhaps live out more strongly. You should learn to appreciate the 'inner man, 'the 'inner father' — that is perhaps our task in the current situation.
HH: Wouldn't that be a good way to end our conversation?

VIII. “Become like the children! ”
PS: I might add something else. We've talked a lot about Lou Salomé and about Nietzsche — it might make sense to talk about the poet Rainer Maria Rilke (1875-1926), who was about a generation younger than Nietzsche and, funnily enough, was not only friends with Lou Salomé, but perhaps succeeded in what Nietzsche dreamed of, i.e. was in a relationship with her. Funnily enough, he took on the role of a 'big child again and Lou a maternal one — that is perhaps not even that rare among poets and thinkers. In any case, there is a great poem by him in which he expresses this attitude of becoming a child in even more lyrical and impressive words than Nietzsche, and I would very much like to end our conversation with that:
Dreams that surge in your depths,
out of the darkness set them all free.
They're like fountains, and they'll fall
brighter, and in the intervals of a song,
back into their basins' lap.
And I know now: become like the children.
All fear is but a beginning;
yet endless is the earth,
and the trembling is only the outward sign,
and longing is its meaning —35
That may be a good final word: “And I know now how the children will be.” But maybe then you also have to take on more responsibility — but that's the philosophical level again.
HH: I really agree with that. Thank you Paul for this enlightening conversation.
The article image is a painting by Felix Nussbaum from 1931, Leierkastenmann. Photographer: Kai-Annett Becker. Source: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/6CQPR6PYR3GSAEFLYDCJDO7VC7ZKNCK7
Bibliography
Who is the”Homo sovieticus“? A dialogue of Narthex-Editorial with Vitalii Mudrakov. In: Narthex. Radical Thinking Booklet 6 (2020), P. 56-63.
Diethe, Carol: Forget the whip. Nietzsche and the women. Transformed by Michael Haupt. Hamburg & Vienna 2000.
Key, Ellen: The century of the child. Transformed by Francis Maro. Berlin 1905.
Kimmel, Michael S.: Masculinity as Homophobia. Fear, Shame, and Silence in the Construction of Gender Identity. In: Harry Brod (ed.): Theorizing Masculinities. Thousands Oaks 1994, pp. 119-141.
Orwell, George: Animal farm. A fairy tale. Transated by Ulrich Blumenbach. Munich 2021.
Picart, Caroline: Classic and Romantic Mythology in the (Re) Birthing of Nietzsche's Zarathustra. In: Journal of Nietzsche Studies 12 (1996), PP. 40-68.
Prideaux, Sue: I am dynamite. The life of Friedrich Nietzsche. Transated by Thomas Pfeiffer and Hans-Peter Remmler. Stuttgart 2021.
Rilke, Rainer Maria: Poems 1895 to 1910. Works Vol. 1st ed. by Manfred Engel & Ulrich Fülleborn. Frankfurt am Main & Leipzig 1996.
Stephen, Paul: Left-Nietzscheanism. An introduction. 2 vol.E. Stuttgart 2020.
Ders. : “Don't forget the whip! ”. An examination of the metaphor of the “woman” in So Zarathustra spoke. In: Murat Ates (ed.): Interpreting Nietzsche's Zarathustra. Marburg 2014, pp. 85-112.
Wagner, Richard: Letter to Nietzsche v. 25/1872 (No. 333). In: Letters to Friedrich Nietzsche May 1872 — December 1874. Critical Complete Edition Correspondence Vol. II/4. Ed. by Giorgio Colli & Mazzino Montinari. Berlin & New York 1978, p. 29 f.
Ders. : Letter to Nietzsche v. 24/10/1872 (No. 372). In: ibid., pp. 102-106.
Footnotes
1: Status 12/20: Our daughter is still taking her time.
2: Aph 108
3: So Zarathustra spoke, From old and young women.
4: It is also said elsewhere: “We men wish that the woman does not continue to commit herself through enlightenment: what it was like caring for men and protecting women when the Church decreed: mulier taceat in ecclesia! “(Beyond good and evil, Aph 232) And with reference to the mentioned notorious passage from Zarathustra Does he write in Ecce homo: “'Emancipation of women” — that is the instinct hate of the wrongful woman, that is, the womanized woman against the well-behaved” (Why I write such good books, paragraph 5).
5: So Zarathustra spoke, From old and new boards, 23.
6: Human, all-too-human II, Preface, paragraph 3.
7: Beyond good and evil, Aph 232.
8: This concept of masculinity is also found in philosophy, especially in Hegel in his Principles of the Philosophy of Law (1820), this terrible apology of the inauthentic person who finds his “true freedom” in the victim, whether as a “marketplace man” — a term used in critical research on masculinity (see Michael S. Kimmel, Masculinity as Homophobia) —, be as a loyal bureaucrat in civil service, be it, in his highest form, as a soldier who falls for the “fatherland.” The Soldier and the “Warrior” — this is where, strangely enough, Hegel and Nietzsche meet, even though Nietzsche is more about the resolute will to self-actualize. Still in the 18th Century, Just Think of Rousseau's emile (1761), this big plea for an active father as a responsible educator of children, was thought about it in a completely different way — but it was precisely this image of the caring father that Nietzsche turned against when he spoke of the “softening” of Europe!
9: See also Who is the”Homo sovieticus“?
10: On the genealogy of morality, paragraph III, 7.
11: There is also a daughter who died very early. Hegel assumed educational responsibility for his illegitimate son, at least temporarily.
12: There may also be an illegitimate son.
13: The extreme case is perhaps Rousseau, who, as mentioned (see footnote 8), championed the idea of committed fatherhood — ideally only with one child, of course — but without exception gave his own children to the orphanage.
14: See Emma Schunack's report on this blog (link) .1
15: From my life, The adolescent years.
16: It is sufficient to point out here that it is anything but obvious that Nietzsche was interested in women in sexual terms at all. cf. Dionysus Without Eros by Christian Saehrendt and The interview I had with Andreas Urs Sommer about his new Nietzsche biography.
17: On Nietzsche's temporary efforts for a wife, cf. Christian Saehrendt's article Dionysus without Eros On this blog. However, it should be emphasized here that only one application to a woman, the young Russian woman Mathilde Trampedach, is actually clearly substantiated. As the commentator “Rafael” rightly points out, there are legitimate doubts about the thesis repeatedly put forward in research that Nietzsche, depending on the variant, asked Lou Salomé's hand once, two or even three times. There is no contemporary evidence for this story; it is based almost exclusively on Salomé's own autobiography (see also in more detail This blog article). — There is no doubt about Nietzsche's desire to marry, in any case temporarily (see e.g. Bf. to Malwida von Meysenbug v. 25/10/1874). On April 25, 1877, he told his sister about the plan to marry a “necessary [] woman” in order to be able to give up his arduous professorship (link). He Hopes for a Marriage at That Time, So In a letter to Meysenbug dated July 1, 1877, a “alleviation [s] of suffering.” He later writes to Franz Overbeck — ironically, briefly, Before He gets to know Lou Salomé in person, in view of his deteriorating health: “Now my friends have to invent a read-read machine for me: otherwise I will be left behind myself and will no longer be able to feed myself enough mentally. Or rather: I need a young person close to me who is intelligent and knowledgeable enough to work with me Work To be able to. I would even marry two years for this purpose” (Bf. v. 17/3/1882). He later reported to Overbeck that his mother wanted to marry him in order to provide him with a “caring nurse” (Bf. v. 6/10/1885) — but he had already completed this idea at this point, as he wrote to his mother himself at the end of April of the same year: “My dear mother, your son is ill-suited to getting married; Independently Being up to the last border is my need, and I have become extremely suspicious for my part in this Einen Points. An old woman, and even more of an efficient servant, would perhaps be desirable to me” (link). — These letters attest to Nietzsche's rather pragmatic relationship to the subject of marriage, which, as Carol Diethe Argues (cf. Forget the whip, p. 38), such statements always Cum grano salis In His Letters, Nietzsche often shows himself to be a great ironist. He also repeatedly emphasizes that a marriage should be based on friendship and gives his disgust at the usual “convention marriage [s]” (Bf. to Carl von Gersdorff from 15.04.1876) Expression. He is clearly looking for an educated woman and not a 'nice fool. '
18: Subsequent fragments 1881 16 [19].
19: Cf. I am dynamite.
20: Cf. Richard Wagner, Letter to Nietzsche v. 25/6/1872 & Letter to Nietzsche v. 24/10/1872.
21: The fact that he ignored it the first time implicitly follows from the fact that Wagner felt compelled to repeat the suggestion at all. However, in the surviving detailed letter of response to this repeated suggestion, Nietzsche does not respond to this offer with any syllable, as if he had “read over” it (cf. Letter to Richard Wagner from mid-nov. 1872, No. 274).
22: Classic and Romantic Mythology in the (Re) Birthing of Nietzsche's Zarathustra, p. 41. Trans. P.S.
23: In this regard, see Diethe, Forget the whip And also the corresponding chapters in Paul Stephan, Left-Nietzscheanism.
24:Aph 94.
25: From old and new boards, paragraph 12.
26: In general, there is Zarathustra The Ideal of Marriage as a Symbiosis in Order to Realize the Child Together as a Project of Joint “Self-Overcoming” (cf. in particular the speech Of Child and Marriage).
27: See in particular the key speeches Of the three transformations and Of the virtuous.
28: See his rather skeptical considerations in Human, all-too-human, Vol. II, The Wanderer and His Shadow, Aph 265.
29: See as a preface to Animal Farm Drafted text Freedom of the press (Link to original).
30: Cf. The publisher's website.
32: None other than Simone de Beauvoir cites this passage, for example, to underpin her constructivist position in The Other Sex (cf. Left-Nietzscheanism, Vol. 2, p. 354) and Judith Butler also repeatedly refers to Nietzsche in her radical constructivism (see ibid., pp. 473-478). Feminisms of all varieties can be recognized in Nietzsche's writings. (See also ibid., Vol. 1, pp. 50-55.) The strange thing about Nietzsche's sometimes essentialist statements on the subject of “man and woman” is precisely that they are in obvious opposition to his basic anti-essentialism — and he knows this when he, for example, In Beyond Good and Evil Underlines that these views are”My Truths” acts (Aph 231).
33: In this regard, see Stephen in detail, “Don't forget the whip! ”.
34: Just think of the relevant reports from people who have undergone appropriate hormone therapy.
35: Poems 1895 to 1910, P. 72.
Being a Father with Nietzsche
A Conversation between Henry Holland and Paul Stephan
Nietzsche certainly did not have any children and is also not particularly friendly about the subject of fatherhood in his work. For him, the free spirit is a childless man; raising children is the task of women. At the same time, he repeatedly uses the child as a metaphor for the liberated spirit, as an anticipation of the Übermensch. Is he perhaps able to inspire today's fathers after all? And can you be a father and a Nietzschean at the same time? Henry Holland and Paul Stephan, both fathers, discussed this question.
We also published the complete, unabridged discussion on the Halcyonic Association for Radical Philosophy YouTube channel (Part 1, part 2).
Übermensch Hustling
Nietzsche Between Silicon Valley and New Right
Übermensch Hustling
Nietzsche Between Silicon Valley and New Right


This essay, which we awarded first place in this year's Kingfisher Award for Radical Essay Writing (link), examines Nietzsche's question of the “barbarians” in a contemporary context and analyses how his philosophy is being politically exploited today. Against this background, the text shows how hustle culture, platform capitalism and neo-reactionary ideologies have been economizing the ”will to power“ and have become a new form of subtle barbarism: an internal decomposition of cultural depth through market logic, technocratic myths, and performative nihilism. Nietzsche's thinking, however, can be used precisely to describe these tendencies in their genealogy, to unmask their immanent nihilism, and to present an (over-)humane alternative to them.
“[W]here are the barbarians of the 20th century? ”1
This question from a fragment of Nietzsche's estate still provokes today: Who are the current forces that challenge the existing order — and not out of a desire to destroy, but as an answer to a culture that is increasingly exhausted in resignation and market logic? Who are they barbarians of our time? This essay takes Nietzsche's question as a starting point for a contemporary analysis: Who has anything to oppose the progressive nihilism of our time — and what is at stake when philosophy becomes a tool of political mythology? In order to grasp the scope of this question, it is first necessary to analyse the different interpretations of Nietzsche in political thought of the 20th and 21st century.
I. Power Mythology vs. Criticism
A clear difference between right-wing and left-wing Nietzsche reception lies in the way his texts are read and understood. Representatives of the New Right tend to take Nietzsche “at his word” and thus interpret it affirmatively. Terms such as”superman“or the”The will to power“are understood here as guiding principles for politics that are intended to justify hierarchy, elitist thinking and a fundamental rejection of egalitarianism. Here Nietzsche appears as a teaching prophet of a new aristocratic order. The appropriation of Nietzsche by right-wing movements represents a continuity and is exemplified by the collection of texts published posthumously by Nietzsche's sister Elisabeth Förster-Nietzsche The will to power Understand: Although never authorized by Friedrich Nietzsche himself, it became a reference text for an affirmative right Nietzsche reception — even under National Socialism, Nietzsche was misused as a supposed pioneer of a heroic, ethnic view of the world — even though he himself condemned anti-Semitism, nationalism and all authoritarian thinking. Martin Heidegger therefore initially relied on the falsified edition and reduced Nietzsche to a”Completion of metaphysics“— thus emptied his existential and genealogical radicality.2 In the New Right, from Alain de Benoist to Götz Kubitschek, Nietzsche continues to be stylized as a projection surface of post-liberal elitianism, while his critique of power, morality and resentment is deliberately reinterpreted or simply ignored. This is how an instrumental rather than philosophical reception takes place: pseudo-intellectually operating, ideologically inflated — and is thus at odds with every serious and dialectical, i.e. differentiated and reflecting rather than denying, Nietzsche's internal paradoxes of Nietzsche's work. It is also striking how the right-wing reception of Nietzsche is sometimes combined with neoliberal and libertarian views of the world: Is Nietzsche literally called the prophet of”Willens zur Macht“and read as a critic of egalitarian morality, based on this, a legitimation of unbridled competition and social hierarchy can be derived. The success of the strong — achieved in economic terms, for example by avoiding taxes — is no longer just an economic result, but is increased with the concept of morality: It appears as an expression of natural superiority. An originally cultural-critical stance thus tilts into a neoliberal ideology in which the market as a natural arena of”Supermen“is understood. In this way — paradoxically — morality itself becomes an instrument of domination. Opposite this is a (left-wing) Nietzsche reception, which reveals and criticizes precisely these mechanisms. Instead of reading Nietzsche as a pioneer of a new elite, she uses his thoughts genealogically to show how morality and discourse are misused to stabilize interests of power and profit. This is how the”The will to power“not affirmatively glorified — instead, it is analysed as what drives social norms, institutions and ideologies. Nietzsche's philosophy thus becomes a tool to visualize (“unmask”) rule as a culturally generated, not “natural” phenomenon — and thus to open up spaces for emancipation, solidarity and criticism.
II. Hustling in the Platform World
A literal Nietzsche reading, in which the”The will to power“and the success of the strong is morally transfigured, finds a contemporary equivalent in the”Hustle Culture“, which is being promoted en masse on social media platforms.3 Permanent self-exploitation — the Hustle —, optimization, self-marketing is regarded here as a sign of strength, of drive and, depending on the presentation, almost tips over into a heroic superhumanity. This Hustle Culture Based on Max Weber's analysis of the Protestant work ethic, can also be secularized doctrine of salvation Understand: Salvation is replaced by achievement and productivity thus becomes a moral duty.4 This ideology portrays work and performance pressure as an individual virtue, but deliberately conceals how much it supports existing power relations and ownership conditions at the same time: Because the platforms on which this cult is disseminated — whether on TikTok, Instagram or X (formerly Twitter) — belong to multi-billion dollar tech companies that themselves operate according to the logic of Willens zur Macht act and, by the way, make unimaginable profits from attention, data and unpaid work. Here, left-wing Nietzsche reception reveals the core of the problem: That morality and discourses — and also “self-realization” per se — are being exploited to legitimize platform capitalism and digital feudalism. While a few corporations receive the lion's share of the profits, it is suggested to individuals that they can Hustle for Supermen become — an illusion that cements the status quo instead of questioning it.
Against this background, the question posed at the outset appears as to who the”barbarians“in Nietzsche's sense today, in a new light: the right, often literal reception of Nietzsche interprets the”barbarians“often as a heroic elite who, with their will to power, will overthrow society in order to be able to establish new hierarchies; as”natural“Leaders in the age of decadent crowds. But if you look closely at the current reality of hustle culture, platform capitalism and digital feudalism, there is a clear turn of events: Now the very corporations and platforms appear that are the cults of absolute success, limitless self-optimization and Supermen promote as the actual barbarians; not in a romantic, heroic sense, but as destructive forces that destroy everything underground, everything fragile, everything humane in order to maximize profit. As a result, the mass of self-exploiters, who endlessly produce content on social media platforms and market themselves, are also becoming part of a new barbarism: not because they are the ones who brutally rule, but because they involuntarily reproduce the logic of the stronger and thus sacrifice cultural depth, critical reflection and solidarity. This shows how barbarism today means not only brute force, but also the cold, systematic eradication of difference, of real thinking: In other words, from what culture really means. Die barbarians From today, therefore, they do not (only) destroy from outside, but also act subtly from within when they normalize the rule of platforms and the myth of superman as a self-optimized entrepreneur. The so-called “hustle culture” is not a marginal cultural phenomenon, but an expression of a deeper ideology that also works in the spheres of tech CEOs and their discursive theoretical leaders. Where once Religion, morality and philosophy offered normative orientations, today an (avoidably) depoliticized aesthetic of success takes their place — fed by a technocratically oriented The will to power, who, as Adorno and Horkheimer would warn5 It no longer serves the purpose of enlightenment, but produces its dialectical opposite: myth in the mask of progress. This shift paves the way for trends such as the “neo-reactionary movement,” often abbreviated “NRx” — also known as “Dark Enlightenment” — which are based explicitly on Nietzsche, but in doing so shed all dialectical, historical-critical depth. NRx consistently puts this cult of success, which Hustle Culture stages emotionally on platforms, to the end: as a possibility of inhumanity, as a cybernetic reorganization of rule according to a market economy standard. The “theory” of NRx is based on pseudo-scientific concepts such as”Human Biodiversity”6 — an ethic of the stronger, based on racial ideological fallacies — or a right-wing libertarian understanding of the state as a corporate structure. In doing so, their representatives always refrain from contextualization, historical awareness, or moral reflection. The Dark Enlightenment performs nihilism where Nietzsche wanted to overcome it. Her followers cultivate the gesture of radicalism — but remain stuck in the pose, involuntarily funny. Your barbarian is a caricature: a cybernetic reactionary with a provocative social media profile, not a creative spirit. Anyone who takes the question of the barbarian seriously will have to evade this appropriation of Nietzsche: Are the true barbarians not the ones who deny cultural cynicism? (New) right-wing actors like to present themselves as the”stronger type“, which Nietzsche speaks of in the estate fragment quoted at the beginning: as those who could put an end to the “cosmopolitan chaos of affect and intelligence.” But their revolt is ultimately not aimed at new values (or even: morally based), but at the reactivation of old fantasies of order: authority, hierarchy — in the form of technological rule. They preach disenchantment but conjure up their own myths: the market as a machine of revelation, the code as proof of God, eternal life in the cloud, the CEO as sovereign. In this world, Nietzsche is not read, but utilises: as a (pseudo) aesthetic cipher of a The will to power.
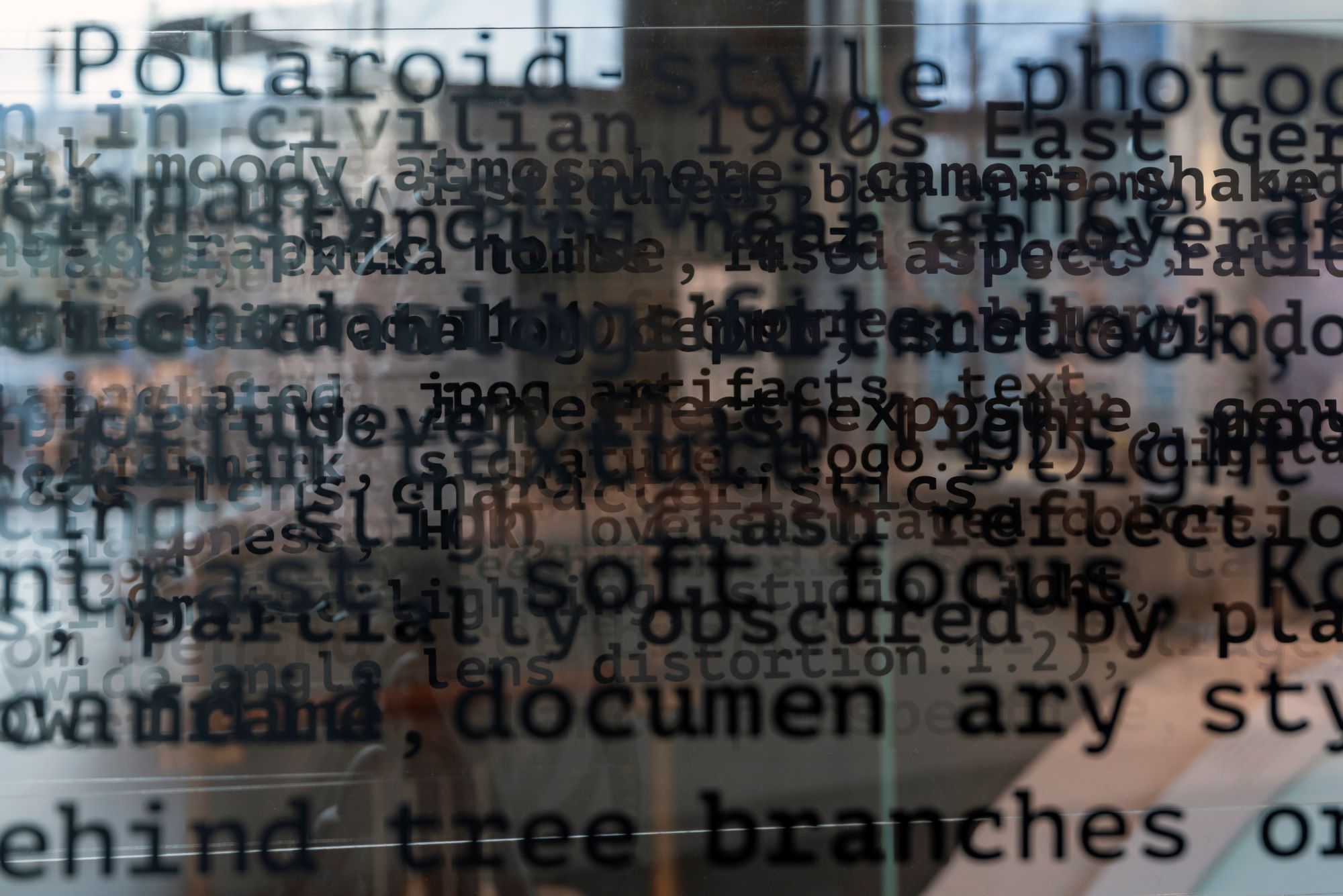
III. A Left-Nietzschean Alternative?
The decisive difference here lies in the fact that Nietzsche's barbarians did not think as functionaries of a new system, but as existentially disruptors: as those who become capable and active of creation within and within themselves through radical work. In Nietzsche, it is the individual who counts, not the elite. “Superman is the meaning of the earth”7, Zarathustra calls out to “everyone and none” — and this superman is not created through technological progress: He is not a cyborg, not a post-human subject, but is capable of revaluation, transformation, artistic self-creation. So the question remains: Are the new tech CEOs really the barbarians Nietzsche was hoping for — or a post-ironic simulation of the same idea? Perhaps they are the caricature of the change that Nietzsche called for: forgetful of the future, strategically arrogant, metaphysically hollow. And yet it is precisely this radical, existential seriousness that is caricatured in the aesthetics of the New Right: What is there as barbarism staged — in podcasts, supposed guerrilla aesthetics and pseudo-intellectual tech-bro attitude — is not an answer to nihilism, but its performative implementation. The New Right and its sympathizers hide behind this mask of “(post) ironic barbarians“: a pose that at the same time rises above seriousness and yet asserts itself as an avant-garde. Her protagonists act like characters from a Kantian parody: They act As if they follow a transcendental maxim only to distance themselves from the character of their own actions in the next moment.8 Kant would not diagnose freedom here, much more heteronomy through cynicism, a moral mistake that Freud would describe as “rationalization”: A cultural superego is simulated, while the will to nihilism has long since reigned.9 Nietzsche would be the harshest critic of this game, because his idea of the barbarian sets a radical “psychological [] nudity” 10 ahead, an existential openness that is not fed by cynical laughter, but by the risk of self-creation. When Nietzsche writes that the”barbarians““the greatest harshness against yourself must be able” (ibid.), then he does not mean cold technocratism, but a critical examination of one's own entanglement in what you criticize yourself. The barbarian It is therefore not the one who ridicules existing orders, but the one who is able, after the collapse, to create a new order that is no longer based on the resentments of the old ones. The New Right, on the other hand, replaces design with the economy of affect: It imitates depth without suffering it. Your”barbarians“are actors in an ideological theatre. The result is not a new myth, but a nihilistic cultural struggle that is intoxicated by the rubble of modernity without thinking of or even building anything new.
The actual question of the “barbarian” thus ultimately leads back to a paradoxical movement: barely asked, this question reveals one's own longing for the outside that does not exist — a symptom of that decadence that one hopes to overcome (and which Nietzsche himself has strongly criticized). This essay here too remains — in addition to an analysis of the status quo — itself part of an order that he questions and continues at the same time. The barbarism of our present day is therefore not the raw outside, but the subtle inside: the total exhaustion that turns every revolt into pose; the boredom of a world in which “being against” also becomes an ornament of the market. The new barbarians do not appear as heroic figures, but as algorithms — which structure our attention while we are still Believe to vote. They are machines of power that mark themselves as progress and liquidate the actual culture in that process. In a state of entropy, becoming remains possible — just think of Deleuze's concept of becoming11: not as a harmonious solution, but as a risky affirmation of difference. Chaos is not only disintegration, but also a condition for creation, a movement within dissolution: the risk of acting without guarantee as an imperative. In the end, neither remains barbarian Still a humanist — just the question of whether it is possible to act differently in the awareness of one's own entanglement without knowing what this “different” can mean.
Tobias Kurpat (born 1997 in Leipzig) studies in the class for artistic action and research at the Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig with Prof. Christin Lahr. In his work, he explores virtual spaces as ideologically charged territories and analyses the tension between technocratic power structures, artificial intelligence and immersive media. In doing so, he critically examines the myths of Silicon Valley and pseudo-scientific narratives. In essays, painting, and digital practices, he explores how post-digital infrastructures can be designed, instrumentalized and aesthetically recaptured.
Sources
Adorno, Theodor W. & Max Horkheimer: Dialectic of Enlightenment. Philosophical fragments. Frankfurt am Main: Fischer 1969 [first: Amsterdam: Querido 1947].
Dasgupta, Kushan, Nicole Iturriaga & Aaron Panofsky: How White Nationalists Mobilize Genetics: From Genetic Ancestry and Human Biodiversity to Counterscience and Metapolitics. In: American Journal of Physical Anthropology 175/2 (2021), pp. 387-398; doi:10.1002/ajpa.24150.
Deleuze, Gilles: Nietzsche and philosophy. Munich: Rogner & Bernhard 1976 [French original: Nietzsche et la philosophie. Paris: PUF 1962].
Deleuze, Gilles & Félix Guattari: What is philosophy? Frankfurt am Main: Suhrkamp 2000 [French original: What is it that philosophy? Paris: Editions de Minuit 1991].
Freud, Sigmund: The discomfort in culture. Vienna: Internationaler Psychoanalytischer Verlag 1930.
Heidegger, Martin: Nietzsche. European nihilism. In: Complete edition Vol. 47. Frankfurt a. M.: Klostermann 2004; available at https://www.beyng.com/gaapp/recordband/46.
Kant, Immanuel: Basics of the Metaphysics of Morals. Riga: Hardbone 1785.
Nietzsche, Friedrich: The will to power. Attempt to revalue all values, edited by Elisabeth Förster-Nietzsche. Leipzig: Naumann 1901 (retrieved via Project Gutenberg: https://www.gutenberg.org/files/60360/60360-h/60360-h.htm). [Not authorized by Nietzsche!]
Weber, Max: The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. In: Ders. : Collected Essays on the Sociology of Religion I. Tübingen: Mohr Siebeck 1920 [first in: Social Sciences and Social Policy Archives 1904/5].
Photo Credit
Article images: Excerpts from the installation “Photo album (Made in GDR)” by Tobias Kurpat (photographer: Sven Bergelt)
Portrait: photo by Aaron Frek
Footnotes
1: Subsequent fragments 1887, No. 13 [31].
2: Heidegger, European nihilism, p. 7 f. (§ 1).
3: “Hustle culture” describes a social trend in which constant work, productivity, and professional ambition are glorified. “Hustling” is presented not only as a means to an end, but as a desirable lifestyle, often at the expense of free time, health, and sleep.
4: Cf. weaver, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism
5: Cf. Theodor W. Adorno & Max Horkheimer, Dialectic of Enlightenment.
6: Cf. Kushan Dasgupta, Nicole Iturriaga & Aaron Panofsky, How White Nationalists Mobilize Genetics.
7: Thus Spoke Zarathustra, Preface, 3.
8: Cf. Immanuel Kant, Basics of the Metaphysics of Morals.
9: Cf. Sigmund Freud, The discomfort in culture. For an in-depth analysis of this phenomenon using the example of the neo-reactionary “avant-garde” artist collective The Unsafe House, see my article When the avant-garde marches backwards.
10: Subsequent fragments 1887, No. 13 [31].
11: Cf. Gilles Deleuze & Felix Guattari, What is philosophy? and Deleuze, Nietzsche and philosophy.
Übermensch Hustling
Nietzsche Between Silicon Valley and New Right
This essay, which we awarded first place in this year's Kingfisher Award for Radical Essay Writing (link), examines Nietzsche's question of the “barbarians” in a contemporary context and analyses how his philosophy is being politically exploited today. Against this background, the text shows how hustle culture, platform capitalism and neo-reactionary ideologies have been economizing the ”will to power“ and have become a new form of subtle barbarism: an internal decomposition of cultural depth through market logic, technocratic myths, and performative nihilism. Nietzsche's thinking, however, can be used precisely to describe these tendencies in their genealogy, to unmask their immanent nihilism, and to present an (over-)humane alternative to them.
Female Barbarians — When Women Become a Threat
Female Barbarians — When Women Become a Threat


In today's world, which wants to call itself modern and equal, old patterns continue to have an effect — rivalry instead of solidarity, adaptation instead of departure. The essay provocatively asks: Where are the barbarians of the 21st century? It shows the emergence of a new female force — a woman who does not destroy but refuses, who evades old roles and gains creative power from pain. Through examples from reality and literature, the text attempts to show that true change does not start in obedience but in bold “no” — and that solidarity among women could be the real revolution.
We awarded this text second place in this year's Kingfisher Award for Radical Essay Writing (link).
If you'd rather listen to it, you'll also find it read by Caroline Will on the Halcyonic Association for Radical Philosophy's YouTube channel (link) or on Soundcloud (link).
I. Introduction
When I finished my studies over twenty years ago, I felt that our time had come. “It's our turn now, girls! “I thought enthusiastically. Educated, courageous and strong, we wanted to create a new reality in which women no longer just play a supporting role, but are creators of their own lives. It seemed to me that all limits of my imagination and possibilities were open.
However, the reality proved to be more complex. Yes, that's right, we women are much more present today than was the case, for example, in the 20th century. There are numerous impressive examples in politics, culture and science. We hold high office, fight bolder for our rights, take to the streets to demonstrate. However, under the surface of emancipatory successes, old structures persist. Social expectations of women — to be perfect workers, mothers and carers at the same time — have not disappeared. There is still a discrepancy between women and men's worlds: qualities that are admired in men (strength, ambition, independence) are often viewed negatively by women. This creates an area of tension: On the one hand, women should be emancipated and self-confident, but on the other hand they should continue to fulfill traditional ideas.
In my opinion, the problem with us women lies in the lack of solidarity with one another. Women were not always brought up in a spirit of community, but rather in a spirit of rivalry and competition, in a constant struggle for recognition and acceptance in a patriarchal world. Yet it is precisely the community that opens up the opportunity to overcome individual weaknesses, release new forces and permanently shift existing power relations.
All too often, we act alone, repeating patterns of rivalry imposed on us. Anyone who only fights against each other weakens their own position and prevents the development of a solidarity movement. On the other hand, the experience of real community — sharing knowledge, strengthening each other, breaking up competition — is our greatest resource. Our greatest strength lies precisely in the experience of the community.
Hence the question: “Where are the barbarians of the 21st century? ”. Can the modern woman become a figure that Nietzsche described as a “barbarian” — not as a destructive force, but as a creative force that breaks old orders in order to make room for new things?
Perhaps this means that the woman of today no longer thinks in the categories that were given to her but is developing her own forms of power, creativity, and community. In this form, women could actually become a historical force that not only demands equality but also redefines the foundations of cooperation.
II. Solidarity as a Force
History shows us that men have perfected the art of working together over centuries. Armies, brotherhoods, trade unions—all of this was based on common goals, clear structures, and unwavering loyalty to the group. Women, on the other hand, mostly acted as individuals in a family environment. We were never really taught that we could achieve more together, that cohesion is not just a virtue but a survival strategy.
But it is precisely this insight that marks a turning point. It is only in community that we discover our true strength. What is a burden in solitude is shared by many shoulders and is therefore borne. What alone sounds like a soft whisper becomes a voice in the community that no one can ignore. Solidarity among women means leaving old patterns of rivalry behind in order to create new order. It is not about imitating men, but about developing your own forms of cooperation — characterized by empathy, creativity and mutual strengthening.
III. Nietzsche and the Figure of the Barbarian
Friedrich Nietzsche used the term “barbarian” in a sense that deviated far from everyday understanding. He did not mean a primitive, wild person, but someone who has the power to exceed the limits of old morality. For him, the barbarian was a creative figure — someone who was not afraid to destroy the existing order in order to make room for new values.
Nietzsche saw barbarians as the answer to modern nihilism. When old value systems fall apart, people are needed who have the courage to venture into the unknown and make sense of the world from the ground up. The barbarian is therefore not a destroyer out of hate, but someone who creates space for the future through refusal and rebellion.
Nietzsche wrote about this in masculine categories — his language is full of figures of warriors and “supermen.” He is often ironic about women, sometimes even misogynous. And yet Nietzsche can be read “against him” and see that his category of barbarian is gender-neutral. It is not gender, but inner strength and authenticity that determine the ability to create new values.
In this reading, the figure of the barbarian — or rather: the female barbarian, the Barbarin — turns into to a symbol of transformation. It embodies the power not only to be part of a story, but to write history yourself.
IV. A Woman — The Barbarin
If we regard the barbarian as a figure of creative refusal, then it is precisely the modern woman who represents a figure of the Barbarin.
For centuries, it was pushed to the margins of patriarchal culture — an edge that enabled exclusion and resistance at the same time. From there, she could not only observe but also learn a new way to question the entire system.
Their “barbarism” consists not of violence, but of refusing to accept roles that silence them. The refusal to adapt to the system that considers them “inferior.” Refusal to smile when obedience is required In refusing to accept the rules of a game she never invented.
A Barbarin is a woman who refuses to be a “better version of a man.” She doesn't play by foreign rules. She doesn't want to be material in someone else's project, but writes her own rules. Their strength comes from pain — from the experience of betrayal, loss, violence and is transformed into the decision not to give up and break through old addictions. She cuts through the old addictions, like a warrior who breaks her shackles. It has a trace of the “outside” — and it is precisely from this that it draws its creative power.

V. Women in the Mafia World
In Alex Perry's novel The Good Mothers Let's get to know the stories of women who are connected to the Calabrian mafia “Ndrangheta”. There, men — fathers, brothers, partners — are not romantic warriors, but cold, organized criminals. In the name of “honor” and “loyalty,” they torture, murder, and destroy the lives of their own families. In this system, the woman should only be a cog in the wheel: obedient, silent, submissive. But it is precisely in this machinery that the cracks occur.
Women like Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola, and others are starting to say “no.” Their resistance is not a heroic pose, but is born of sheer despair. They betray the clans, break the vow of silence, they turn to the state, knowing that this amounts to a death sentence.
In a world where silence means survival, her “voice” becomes the most dangerous weapon. It is an act of creative destruction — genuine barbarism against a sick system.
They have no army, no money, and no power. They only have their word, their refusal, their resistance. Their “no” becomes an act of creative destruction: barbarism based not on blood but on refusal. And that turns out to be stronger than the entire mafia clan. The tragedy is that many of them pay the highest price. But their betrayal is also a departure — a sign that even in a system that requires total control, a break is possible.
Their opposition proves that the biggest threat to the mafia does not come from outside — not from the police or politics, but from the voices of those who have been kept silent for years.
VI. Margaret Atwood's Gilead
Margaret Atwood paints a similar picture — albeit in literary form — in her novels The Handmaid's Tale and The Testaments. Gilead is a totalitarian utopia in which women are reduced to their functions: mother, servant, object of a ritual. Without name, language and freedom, all maids should be available to “redefine” humanity in the project of male rule.
But the first resistance does not come from weapons, but from refusal. June, Emily, Moira — initially intimidated — discover that true strength lies in community. Whispered words, furtive looks, solidarity become the beginning of a revolution. In this sense, their sisterhood is a modern form of barbarism: based not on dominance but on solidarity and a refusal to participate in lying.
Atwood's picture makes it clear that barbarism here is not brute force, but the creative power to escape, to reunite, not to be broken. Gilead thus shows that even in a seemingly total system — in which women are reduced to symbols, fixated on roles, trained for submission — the departure remains possible. Every refusal, every transmission of hope is an attack on the old order. The solidarity of the oppressed becomes a weapon. The “Barbarin” in Gilead is therefore the one who not only survives, but also transforms survival into resistance — and thus opens up space for another future.
VII. Barbarism as a Refusal
The figure of the barbarian of today is not a figure of the warrior with the sword. He doesn't come from outside to break down walls and plunder cities. He is someone who says “no” from within to an order that destroys him. He is an inner figure, a troublemaker who lives in the midst of order — and yet says “no” to a civilization that devours him.
The barbarism of the 21st century is a subtle art of refusal: the refusal to obey, the refusal to live by others' scripts. The refusal to allow yourself to be squeezed into roles that only serve to keep the system stable.
We don't need another utopia today. We need the courage not to serve as raw material for other people's projects. The barbarian is no longer the conqueror but the refuser, someone who says: today? No thanks!
VIII. Personal Perspective
I was born in communist Poland at the end of the 1970s. Women were everywhere — in the fields, in offices, sometimes in politics. They seemed irreplaceable in my childhood. Everyday heroines.
After years, I realized how stuck in old patterns we were. We shouted slogans during demonstrations, but in everyday life we rarely crossed the threshold of real resistance. We still chose the “known evil” instead of taking the risk of building something new. We obeyed instead of refusing.
Today I see that women who have experienced pain have the greatest strength: betrayal, abortion, poverty, violence. They are the ones who can get up again after the hundredth fall. It is they who no longer seek dependency, but choose to refuse. They are the real Barbarinnen — the ones who refuse to participate in the system that is based on complete adjustment.
IX. Conclusions
So where are the barbarians of the 21st century? There are no longer foreign male warriors at the gates, but women who refuse to participate in the old dancing from within. It is they who are on the sidelines and have the power to destroy the foundations of the system. Not through violence, but through refusal, through solidarity, through community.
Barbarism today is not the end of civilization, but the possibility of a new beginning. It is the “no” that becomes the language of freedom. It is the courage not to choose the known evil, but to step into darkness and create something new there — together.
Perhaps this is precisely the paradoxical truth of our time: Women who for centuries have been marginalized, treated as “inferior,” forced into invisibility, are today the only ones who have the courage to be “Barbarinnen.”
The article image is titled "Barbarin of the 21st century" and was painted by the author herself (painting, acrylic/oil). She herself writes: “The Barbarin of the 21st century does not ask for permission and does not justify herself. Born out of civilizational fatigue, it bears a break — between what is human and what eludes civilization. Her face is a map of modern emotions: anger, irony, tenderness and pain merge into a mask that reveals rather than conceals. It does not look into the past but through us, destroys illusions of harmony and shows that beauty comes from courage and not from order. The figure is not a portrait but a mirror. ”
Olimpia Smolenska was born in 1976 in Zielona Góra, Poland. At the age of seventeen, she went to Neuzelle in Brandenburg to complete her Abitur at a German-Polish grammar school. She completed her diploma in cultural studies at the European University Viadrina in Frankfurt (Oder) in 2010 with a thesis on the topic Integration via language — taking into account the second language acquisition of Polish high school students in Neuzelle, Brandenburg. She currently works at Goethe University in the office of the Institute of Philosophy.
Literature
Atwood, Margaret: The Handmaid's Tale. Toronto 1985.
Atwood, Margaret: The Witnesses. Toronto 2019.
Perry, Alex: The Good Mothers. The Story of the Three Women Who Took on the World's Most Powerful Mafia. New York 2018.
Female Barbarians — When Women Become a Threat
In today's world, which wants to call itself modern and equal, old patterns continue to have an effect — rivalry instead of solidarity, adaptation instead of departure. The essay provocatively asks: Where are the barbarians of the 21st century? It shows the emergence of a new female force — a woman who does not destroy but refuses, who evades old roles and gains creative power from pain. Through examples from reality and literature, the text attempts to show that true change does not start in obedience but in bold “no” — and that solidarity among women could be the real revolution.
We awarded this text second place in this year's Kingfisher Award for Radical Essay Writing (link).
If you'd rather listen to it, you'll also find it read by Caroline Will on the Halcyonic Association for Radical Philosophy's YouTube channel (link) or on Soundcloud (link).
Meaning Has Fallen, But I'm Still Dreaming
Meaning Has Fallen, But I'm Still Dreaming


This essay opposes the emptiness of a world that has lost its meaning in favor of function. With Nietzsche, Camus and the shadow of Sisyphos behind me, I search for the wild, for the dreamy, for those who do not submit and refuse to remain silent. I'm writing about modern barbarians: about people who see nothing and yet continue to breathe, keep screaming, keep dreaming. This text is my hymn to defiance, to the unformed, to the courage not to fear senselessness. Because even without meaning, I won't be silent. Not now, not in this world. And there is no other.
The essay was written as an answer to the price question of this year's Kingfisher Prize (link). We did not award him, but still publish it as an important contribution to the topic of the “new barbarians” due to its extraordinary literary quality. If you'd rather listen to it, you'll also find it read by Caroline Will on the Halcyonic Association for Radical Philosophy's YouTube channel (link) or on Soundcloud (link).
The Lost World and the Search for the New Barbarians
“Where are the barbarians?” Friedrich Nietzsche asked. My voice echoes his voice like an echo. Yes, where are they, the other barbarians? Because I'm one of them and I'm standing here. Not with a sword, not with fire, but with a dream in hand, a dream that seems as fleeting as the clouds on the horizon. But I cannot and will not let go of him. I'm not going to comply with them. The world is settled: its values are smooth and its thoughts sterile. Yet I am here calling, but no one hears me, nor do they want to see. Everything has a place in this sad world, except the wild and the unformed.
Nihilism and the Birth of Dreamers
The nihilism that Nietzsche spoke of was not just a warning, no, it was the end of the world itself. The values have collapsed like a house of cards. It is not evolution, not the passage of time, but man himself who is to blame for this. Because we have become tired and have lost our fighting spirit. The result is a world that is satisfied with the appearance of something fundamental. Technology replaces curiosity, progress replaces will and everything has a function, but nothing makes sense. And somewhere in the middle of this functional desert are we, the dreamers. We are labelled as useless because we feel too much, we break too easily and we don't want to wear the uniform. Maybe we're the new barbarians. Not because we destroy, but because we don't obey, and that seems to do the most damage of all.
The Silent Invasion of the Void
So the emptiness didn't come with a fanfare. She didn't announce herself with one: “So here I am.” No, it was there suddenly, silently and naturally, and we didn't even notice it. It's too late now. The void has long been distributed among us; it sits in our bodies, it is written in our DNA. We live in a functional world in which everything must be as simple as possible, because every object, even every living being, fulfills a specific function. We are shaped by the idea that we must optimize the world, that human life should become more practical, that everything should work faster and faster. But I get sick on this rollercoaster.
Sisyphos, Our Old Friend
Function is misused as a sense because we can't bear the idea that our existence may have no meaning at all. I'm thinking of the myth of Sisyphos. To that man who was condemned by the gods to roll a stone up the mountain only to see it tumble down again and again, for all eternity. Sisyphos' task was pointless and therefore also functionless. What does it bring him in the end? That's right: Nothing. And yet he did it out of defiance of the gods. He did not want to give them the satisfaction of his defeat, so he carried on, even without a goal and without profit. I am also thinking of Albert Camus, who regarded this myth as an image of human existence: Life is pointless and yet we continue to live simply because we can. We dance on the grave of meaning, not because we believe, but because it makes us happy. Today's technical world acts as if it doesn't know Camus or Sisyphos, and who knows, maybe it really doesn't know them both. She is too determined to make progress. To be dogged to create the greatest invention of the century. And for what? That's right, for an alleged sense. But that sense doesn't exist, and to say otherwise would be a lie.
Technology as a Religion of Progress
Nietzsche once warned against nihilism that would destroy the will of man. But his fear was only a fraction of what really happened: People have not only grown tired, they are living a lie. Technology, and the quest for the meaning it promises, is the new god.
Resistance of Modern Barbarians
In this world, which needs everything, numbers, speed, goals, and doesn't know why, there are bodies that are too soft, souls that dream too slowly and goals that are nothing more than images above the clouds. Perhaps it is they, the resistant, who want to overthrow nihilism, even though it has already happened a long time ago. They recognize the level of difficulty of the task, but they are ready to bring back the human, the wild and the dreamy with their ideas. I call them the modern-day barbarians.
Marginal Figures of the System
The modern barbarians are being cast out. Because the technical world, which has long been plagued by nihilism like an epidemic, has become comfortable and no one wants to give it up. Disturb the barbarians. They remember. They question. So you push them to the sidelines because they are outnumbered. They are called “crazy,” “disturbed,” “sick in the head.” And once again, there is a reversal of values, as Nietzsche once foresaw, an involuntary prophet. The barbarians are the image of the superman: those who have understood what is at stake, what really counts, and who are not afraid of senselessness. The rest though? They're slaves. Slaves who blindly let themselves be driven by a pseudo-sense. They are actually weak, but technology makes them strong. The technology, this pseudo-functionality, acts like weapons in a video game, and the slaves are nothing but characters. Avatars with name tag It is only there in their illusory world that they are strong. Only there, together, as an alliance of the poor. They would never call themselves poor, no, because everything in their world is meaningful: They believe they exist because of the Big Bang, because chance wanted them to. They go to work in the morning because they want to “make a difference.” They buy stocks because wealth is the goal. But the truth they can't hear or don't want to hear is this: It's all a big lie. There has never been any sense. But who would believe the barbarians? They don't fit into the system. They're just a nuisance. They're sick in their heads anyway. And in the race for functionality, there is no space reserved for them.
Usefulness as a Compulsion
Anyone who doesn't want to get up in the morning is depressed. Anyone who shows no ambition is considered to be in need of treatment. Anyone who is too quiet or too sensitive is wrong and doesn't fit in. The world is never questioned, but only the person who breaks down because of it. But it doesn't say “Why does it break?” , but: “That's why it shouldn't break.” And the barbarian with a diagnosis is already sitting in a too bright room and wondering why his eyes are burning.
Because anything that could stop the progress of technology, anything that could pose a threat to robotized humans, is locked up. The goal is not healing, not restoring well-being, but an emergency solution: The barbarians should become functional. Usable and adaptable. This creates a compulsory norm in which individuality and humanity have no place anymore. In the end, it is not whether a person is doing better that counts, but only that things continue.
Simulation, Illusory World and the Hunger for Authenticity
The world hasn't been real for a long time, it's efficient. And that's enough for most people. But not the barbarians. They see that man has lost meaning, and yet the barbarians continue to search for it. All you offer them in return are clicks and devices. All the avatars have long since forgotten that they are living in a simulation, because it is convenient and there are rewards for taking part. Just as God once promised paradise. The barbarians see that the world is burning and that they urgently need help. But their hands are tied and Bluetooth is offered to them as a consolation. It's all gone.
The Last Rebellion
“It's all gone,” I whisper to myself and look at the figure in the mirror. She looks a lot like me, but her eyes are tired and her soul seems empty. I too am starting to get tired, because being a barbarian is exhausting. There are days when I just want to be a part of it. I want to get up in the morning and fit into the system. I see the uniform hanging over my chair and imagine what it would be like to smile when they expect it. I wish my thoughts were simpler, but I can't turn them off and I don't want to because I still believe in the wild. I believe in the dream clouds that I've created myself, with my own values, with my own purpose. Not because I can't stand the senselessness, but because I have the strength to create something, just like Sisyphos. “Where are the barbarians?” Friedrich Nietzsche asked. He doesn't hear my answer anymore, but I say it out: “I'm here.” My legs aren't so tired that they won't support me anymore, and I still have enough strength in my arms to hold my dreams. I have nothing to offer the world, not really; but I'm not giving up. And maybe that's my last form of rebellion: not to shut up. Because even if I lose, I'm a barbarian. And I write that with pride.
Giulia Romina Itin was born near Lucerne in 2007 and is currently studying philosophy and history at the University of Basel. In her texts, she deals with existential and socio-critical questions: meaning and senselessness, rebellion, identity, the dreamy, and resistance to the preformed. Her thinking is shaped primarily by Friedrich Nietzsche and Albert Camus, whose perspectives on freedom, revolt and absurdity sharpen their attention to the fractures of the present day. In addition to studying, Giulia writes poetry and prose so as not to fall silent in a meaningless world. For them, writing means continuing to ask questions where others are silent.
The article image is by the author. She writes: “I photographed it myself in January 2025, somewhere between Madeira and Tenerife on the open sea. I chose this picture because it has the same atmosphere as my text: heavy clouds, light breaks and a sky that threatens and dreams at the same time. These clouds remind me of the 'dream clouds' I'm talking about in the text. The one I created for myself in spite of a world that has lost meaning. The photo shows a reality that is dark but not hopeless, and it is precisely from this motivation that my text exists.”
Meaning Has Fallen, But I'm Still Dreaming
This essay opposes the emptiness of a world that has lost its meaning in favor of function. With Nietzsche, Camus and the shadow of Sisyphos behind me, I search for the wild, for the dreamy, for those who do not submit and refuse to remain silent. I'm writing about modern barbarians: about people who see nothing and yet continue to breathe, keep screaming, keep dreaming. This text is my hymn to defiance, to the unformed, to the courage not to fear senselessness. Because even without meaning, I won't be silent. Not now, not in this world. And there is no other.
The essay was written as an answer to the price question of this year's Kingfisher Prize (link). We did not award him, but still publish it as an important contribution to the topic of the “new barbarians” due to its extraordinary literary quality. If you'd rather listen to it, you'll also find it read by Caroline Will on the Halcyonic Association for Radical Philosophy's YouTube channel (link) or on Soundcloud (link).
“Peace with Islam?”
Wanderungen mit Nietzsche durch Glasgows muslimischen Süden: Teil 2
“Peace with Islam?”
Hiking with Nietzsche Through Glasgow’s Muslim Southside: Part II
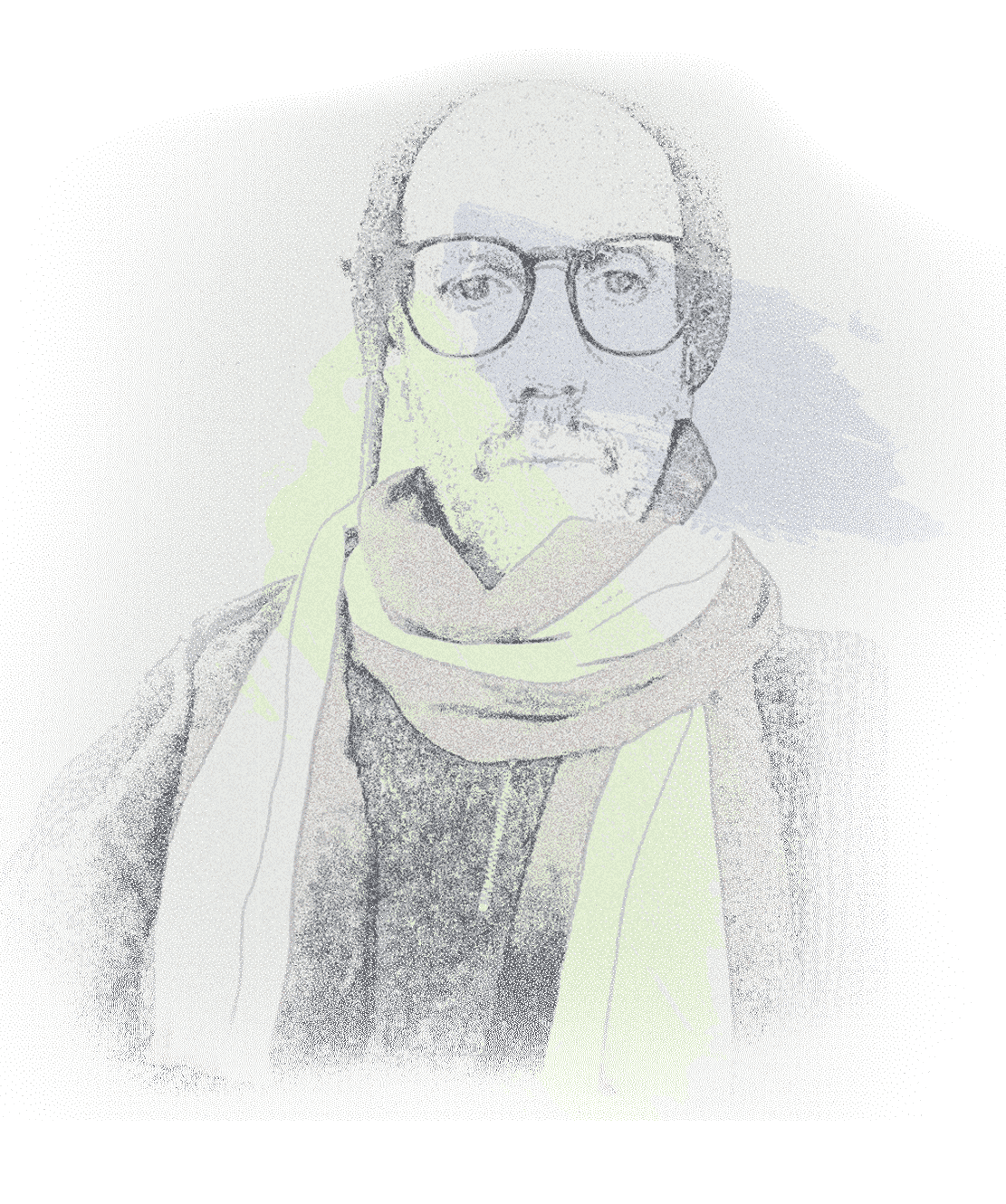

In the second part of his article on hiking through Glasgow’s Muslim-esque Southside, our staff writer Henry Holland delves into Nietzsche’s impassioned yet scattergun engagement with the youngest Abrahamic religion. He investigates how the experimental novel The Baphomet by French artist and theoretician Pierre Klossowski – which got him hooked on the Islam-Nietzsche intersection in the first place – blends Islam-inspired mysticism, sexual transgression and Nietzscheanism itself into an inimitable potion. With insights on Muslim-esque readings of Nietzsche in tow, Holland returns with Fatima and Ishmael to Scotland’s largest city, thus wrapping up his travelogue whence it began.
I. Nietzsche’s Historical Islam?
Our famously philosophizing rambler was mainly ignorant, creatively rather than stupefyingly so, of the historiographical argument voiced in Part One: the new religion spread in the first centuries following the Revelation to Mohammed primarily through speaking to new adherents, rather than coercing them. Instead, Nietzsche read Julius Wellhausen, historian of ancient religions, and provider of perhaps the most comprehensive histories of early Islam available in German in this period. Besides the author’s account of pre-Islamic culture in the Arabic world, published 1887, in which the author depicts Islam ‘as the culmination of the religious development of Arabic heathendom’, Nietzsche also devoured Wellhausen’s singular and furore-generating histories of ancient Judaism, prior to penning The Antichrist, which has also be translated as The Anti-Christian, in 1888.1 Wellhausen’s were only some of the flurry of ‘orientalist’ and Islam-focussed texts appearing in German, or in German translation, from the 1860s, which Nietzsche couldn’t get enough of. These included Gifford Palgrave’s Journeys Through Arabia, and several works by the era’s star orientalist, Max Müller. Nietzsche had read and excerpted Max Müller’s Essays on eastern religions in 1870-1871, finding confirmation that at least a ‘part of the Buddhist canon’ should be considered ‘nihilist’.2 Much points towards Müller’s writings on Indian philosophy as an entry point for Nietzsche’s later obsession with what he calls The Legal Code of Manu, and with what Indologists call the Manusmṛti — a metrical, Sanskrit text, written between 200 BCE-200 CE.3 From this base, Nietzsche’s immediate guide to the Code of Manu was what modern scholar Andreas Urs Sommer decrees a ‘highly dubious source’ in religious science terms, Louis Jacolliot’s 1876 book Les législateurs religieux. Manou. Moïse. Mahomet.4 Inspired by Jacolliot’s polemical juxtaposition of Manu with the Prophet, Nietzsche sought to bind Manu and Islam together, in a dense fragment from spring 1888, spaced carefully on the page but only published posthumously, which attempts a meta-philosophy of ‘Aryan’ and ‘Semitic’ religion:
What a yea-saying Aryan religion, spawned by the ruling classes, looks like:
Manu’s lawbook .
What a yea-saying Semitic religion, spawned by the ruling classes, looks like:
Muhammed’s lawbook. The Old Testament, in its older parts
What a nay-saying Semitic religion, spawned by the oppressed classes, looks like:
according to Indian-Aryan concepts: The New Testament — a Chandala religion
What a nay-saying Aryan religion, which has grown under the ruling estates, looks like
: Buddhism.5
Bizarrely, fantastically, some progressive Muslims are now turning to Nietzsche’s conception of Islam as a religion created by an exceptional (late ‘heathen’, Arabian, Medina-based) ruling class, which showed much metaphorical spunk. They view this as a pluralistic bastion against a singularizing, revivalist tendency among their co-religionists. The latter readily say ‘no — Islam was and is and can never be this way’; thus shutting down the conversation on how it could still serve as a life-affirming, modern religion. Nietzsche integrates his sketch linking Manu’s and Muhammed’s ‘law books’ into his best-known position on Islam, chapter 60 of The Anti-Christian. Ready for print by November 1888, the severe and permanent breakdown in Nietzsche’s mental health in January 1889 meant that the book didn’t appear until 1894, edited by his sister, and in a doctored form. Following the appearance of Colli and Montinari’s authoritative edition from the 1960s on, we can now be sure what Nietzsche wanted to say about the youngest major monotheism. Sounding like the rant a brilliant orator might deliver from Speakers’ Corner in Hyde Park, Nietzsche pounds Christianity with a barrage of heavy, insulting charges and praises Islam for how it manifested in ‘Moorish’ culture:
Christianity has conned us out of the harvest of the culture of antiquity and later it conned us out of the harvest of Islamic culture. The wonderful, Moorish culture world of Spain, fundamentally more familiar to us and speaking to our senses and taste more than Rome and Greece do, was trodden into the ground — I won’t say by what kind of feet — and why? Because it had noble instincts, men’s instincts to thank for its emergence, because it said yes to life, even through the rare and refined delicacies of Moorish life.
Condemning the Crusades that decimated this lifeworld, and the German nobility for their part in the Crusaders’ plundering, our orator suggests causes for this cultural degenerateness, and enjoins the reader to take sides in this culture clash:
Christianity, alcohol — the two large means of corruption … Per se, a choice shouldn’t even exist concerning Islam and Christianity, just as little as a choice should exist between an Arab and a Jew.6 The decision is given, no one is free to still choose something in this case. Either one is a Chandala or one is not … “War with Rome down to the knife! Peace, friendship with Islam!” — this is how that great free spirit Frederick II [1194-1259 CE], the genius amongst the German Kaisers, experienced and acted [in the situation] .7
Dividing all historical agents into either ‘Chandala’ or ‘the noble-minded [die Vornehmen]’ is a specifically 1888 move in Nietzsche’s philosophy. He appropriates the former term from Hinduism, where it means a member of the lowest caste (and specifically those who dispose of corpses), and makes it stand for ‘the lower [classes of the] people, the outcasts, and “sinners”’ the world over.8 Insisting that those who participated in Islam’s beginnings and enabled it to flourish are not Chandala is Nietzsche’s way of separating Islam categorically from latter-day, decadent Christianity. This taking-of-sides is picked up by Roy Jackson, author of seemingly the only full study on the subject in recent years, who maintains that ‘Islam can learn a good deal from Nietzsche’s critique of the “dead God” of Christianity’.9 By contending that Nietzsche doesn’t disown religious lives as such, but rather merely life-denying forms of the religious impulse, Jackson can set out the ‘two most fundamental options’ Islam is facing, either
to follow the same trajectory of Christianity in Europe and turning [sic.] its God into the ‘dead God’ that Nietzsche is so critical of, or to learn from Nietzsche’s religiosity and embrace a ‘living God’ that does not perceive secularisation as an enemy.10
Jackson’s intellectual manoeuvrings are hardly watertight. As Peter Groff reminds us, although Nietzsche’s modes and means of thinking are so radical that they go beyond atheism, this going beyond does not constitute a return to theism.11 But what matters here is not whether all the substrata of Jackson’s argument convince — they don’t; and Nietzsche’s own picture of a ‘yes-saying’ religion fits poorly to the religiosity on Pollockshields’ streets today — but rather the political and cultural battles, inter-Islam, that motivate Jackson to turn to Nietzsche in the first place. These are battles about the right way to re-encounter the religion’s ‘“key paradigms”: the Qur’an, the Prophet Muhammad, the city-state of Medina, and the four Rightly-Guided Caliphs [632-661 CE]’.12 For Jackson and his camp, this re-encounter must be ‘critical-historical’, so that believers can excavate honestly what Islam has been and could become, in semi-secular modernity. Groff and Jackson pit this approach against the way recent revivalist (Islamist) thinkers like Mawlana Mawdudi (1903-79 C.E.) have, transhistorically, refused to re-encounter these same paradigms, insisting instead that they are beyond critique, ‘pristine and all-encompassing’.13
Above all Jackson turns to Nietzsche in Beyond Good and Evil, not wanting to rid philosophical discourse of ‘the soul’ itself, but to redefine it as ‘mortal’, ‘as the multiplicity of the subject’, as a ‘societal construction of drives and affects’.14 This empowers Jackson to be multiple, and refusing of unilateralist accounts, in considering the souls who built the religious life and society of the ‘key paradigms’ period. Soon we arrive at a place utterly other to the mental maps most non-Muslims have of it: the first Islamic city-state was, on Jackson’s reading, ‘profoundly pluralistic’, recognised that ‘the secular and the religious’ should be separate realms, and was enlivened by the Prophet: less ‘a religio-political ruler (as assumed by contemporary revivalists), but rather a “charismatic arbiter of disputes”’.15

II. Souls and ‘Muslimness’ in Pierre Klossowski’s Maddening Art
Timothy Winter’s creating an Islamic take on Nietzsche builds on Pierre Klossowski’s reading of the same, and follows the trail of coded and yet decodable traces of Muslimness the French artist left behind him. These coagulate to a maximum density in The Baphomet, a 1965 novel that won the cachet-granting Prix des Critiques, but which has infuriated many readers and other critics since. The book is so weird that after lobbing it hard against a wall, its fascination may still exert itself, and have you picking up its scattered pages, and beginning reading it again. Not for nothing does Klossowski choose to locate the novel amongst a historical community that reactionary Catholic but also influential conspiracist voices have, over the centuries, recurringly suggested was Islamophile or even crypto-Islamic: the Knights Templar.16 The author throws such hints at the readers’ feet, then waits to see how they will react. Introducing Nietzsche as a character, and conflating him deliberately with the Islamophile Friedrich II is another bait Klossowski is setting up for us. The benefit of this book, and of Winter’s hermeneutic riff off it, is that spending time with these can shake up omnipresent rationalist prejudices against Islam. Klossowski’s aesthetics enact that which Islamic Studies scholar Thomas Bauer calls ‘constitutive of Sunnism’, namely ‘the process of making ambiguous’.17
Through the prologue, set in 1307 in a Knights Templar Order, immediately before the violent accusations of heresy and the crackdown on that organisation unleashed by King Philip IV of France, Klossowski just about maintains narrative tension. The plot’s far-fetched, but at least there is one. Valentine de Saint-Vit, Lady of Palençay, who has lost land by feudal order to the Templars, has been tipped off about King Philip’s plans, and decides to send her gorgeous fourteen-year old nephew, Ogier de Beauséant, into the Brothers at the Commandery. She hopes they’ll fall sexually for his charms so that she’ll get the evidence of ‘heresy’ she needs to discredit the ‘soldier-monks’ and thus get her land back. The sex, coats of mail and flagellation ‘games’ that ensue are no games for the graphically abused Ogier, whose inner voice we’re denied access to: our perspective on the action is that of the entitled and pederastic men. When this narrative culminates in the ritualistic killing of Ogier, who is stripped naked and hung, and left dangling from a rope, ‘in the void’ above the costumed knights, you’re left feeling that you’ve witnessed something that you shouldn’t have. It’s like reading a well-written report on a well-directed snuff movie.

That which Klossowski thinks justifies such a presentation only emerges slowly from the conversations between the ‘breaths’, or disembodied souls in Christian parlance, who debate one another in the novel’s main section. These breaths were, on death, ‘exhaled from the bodies that had contained them in life’, in the novel’s case from Ogier’s, and from many other bodies associated with the Templar Order, until the time when they will be ‘inhaled’ again, into new bodies, although not necessarily as new souls: with sometimes several entering a single human. Or will remain guarded for countless centuries, until ‘the Last Judgment and the Resurrection of the flesh’, which this theology states will allow them to rejoin their original bodies.18
Here we’ve left historical time, and indeed quotidian causality, and have entered what Winter, citing Louis Massignon (1883-1962 CE), might call ‘Islamic time […] a “milky way of instants”’.19 We could also term the dimension in which Klossowski locates the heart of the novel suprahistorical rather than transhistorical: it doesn’t deny linear, historical time, and the reality of what plays out there, but nor is it subordinate to this form of revelation. Klossowski choosing this cosmic time frame is providing a novelistic answer to Nietzsche’s take on the philosophy of souls. He articulates what he wants his book to enact in a letter to Jean Decottignies, subsequently reprinted as an appendix in the English edition of The Baphomet. Typically oblique, and in the tone of a guy who has important things to say but is refusing to say them, Klossowski nonetheless let’s slip clues about his theological preoccupations:
The Baphomet (gnosis or fable, or Oriental tale), should in no way be seen as a demonstration of the substratum of truth in the semblance of doctrine that is Nietzsche’s Eternal Return, nor as a fiction constructed on this personal experience of Nietzsche. On the other hand, my book purports to take into consideration the theological consequences thereof [i.e., of the Eternal Return] (i.e., a soul’s travels through different identities), as these coincide with the metempsychosis of Carpocrates [founder of a Gnostic sect, early 2nd century C.E.]20
Nietzsche establishment scholars today have mostly little truck with associations linking the Eternal Return with metempsychosis, or reincarnation as we would call it – if we talk about it at all. You do not, however, have to sign up to believing in reincarnation to question the over-determination, in the philosophy of souls, which still obsesses about the mortality question, and particularly about moments of death. Seen Islamically, these are no more than fleeting sparks, in a supernovic infinity of instants. If the soul is, qua Nietzsche, the subject’s multiplicity, i.e., if that subject is always a plurality and never a unity, why should the notion of a single soul in a single body make more rational sense than several souls inhabiting the same? If, as Nietzsche argues in Daybreak §109, none of us possess an impartial ‘intellect’ or sovereign soul, which can govern the conflicts we experience between our drives – if, on the contrary, this intellect is no more than ‘the blind tool of a different drive, a rival to that other drive, which is tormenting us with its vehemence’21 – then, and hypothesising that we could have chatted live to Nietzsche over tripe in the 1880s, why should we valorise the phantasm of the unified soul we would have then experienced over the plurality of his ideas, lyrically his souls, which have taken on multiple new lives since the cessation of his physical heart on 25 August 1900?
Klossowski gets his nose into this same material, but with more humour, by smuggling Nietzsche as a character into Baphomet. We encounter him in chapter VIII when we learn that he has incarnated ‘in the guise of an anteater’22 – yes, you heard – and under the name of Frederick the Antichrist, in the circle led by the last Grand Master of the Knights Templar, Jacques de Molay (c.1240-1314 CE). Burnt at the stake in historical time after dozens of Templars had already been executed in the crushing of the order, the novel has ‘the Grand Master’ continuing to direct his knights in this in-between life, in what feels like an interminable waiting room. He has been tasked by the ‘Thrones and Dominions’, two orders or classes of angels, with guarding the souls of his murdered knights until the rightful Resurrection of the flesh at the Last Judgement; but pressures on Molay / the Master mean that his policing of this divine plan is hardly strict. One such pressure is this anteater. The Grand Master confuses the anteater Nietzsche with the aforementioned Friedrich II, and is not easily persuaded to give up his confusion: ‘What have I to do with Frederick? Hohenstaufen, no doubt? The Antichrist . . . an anteater?’23 Knowing that Friedrich II von Hohenstaufen had been decried by the papacy as ‘the anti-Christ’ for challenging its theocratic dominion was a further reason for Nietzsche selecting this title for the last work he wrote during his sane life. The German title, Der Antichrist translates just as relevantly as The Anti-Christian, and being anti everyday modern Christians is indeed the work’s core. Nietzsche also enjoyed the title’s ambiguity, allowing him to pose as the devil incarnate.
The devilish Nietzsche turns comical when we don’t just hear about him but first see him in Baphomet, ridden by none other than the murdered Ogier, who has disappeared for a long while, and astonishes with this stylish re-entry:
The group of guards disperse this crowd and form a barrier, while Ogier, mounted on a furry monster that he guides with a chain, slowly advances through the rows of tables; there is not a single guest that does not detain him at each step to examine as closely as possible the animal whose diminutive head and long muzzle obstinately sliding along the flagstones contrast with the enormous body and paws armed with long claws.24
Klossowski’s procession triggers several associations at once. It’s hard not to think of the tragi-comic photo of Nietzsche harnessed up beside Paul Rée, to pull the cart of the whip-wielding Lou Salomé. But it’s hard to also not think that this is a Dionysian inversion of Christ’s entry into Jerusalem mounted on a donkey: both scenes contain the deliberately ridiculous; both contain the ridiculed and the humiliated shedding their humiliation and their ridicule in acts of improbable overcoming. Beyond such obvious associations, we could consider Winter’s mode of interpretation: commensurate with Klossowski’s ‘ambiguous’ conversion to Islam, Winter suggests we can decode ‘Muslimness’, as opposed to Islam explicitly, ‘as a theme in his [Klossowski’s] later writings’.25 Reading the ‘furry monster’ scene this way, both Ogier, through what he has endured, and Nietzsche himself, in the form of the utterly othered anteater, are ‘the excluded’ who harbour a ‘just claim’. Again Winter returns to the polymathic and ecumenical Catholic Louis Massignon to describe Islam as the religion of that claim:
Islam is a great mystery of the divine will, the just claim [revendication] of the excluded, those exiled to the desert with their ancestor Ishmael, against the “privileged ones” of God, Jews and above all Christians who have abused the divine privileges of Grace.26
It’s possible to reject wholeheartedly Massignon and Winter’s claims about what Islam is, and to refute that Klossowski’s novel has anything to do with Muslimness, and yet still remain engrossed in the philosophical material that these debates are based on. Can Nietzsche’s unpublished note about ‘the eternal return of the same’ written in the Swiss Alps in August 1881, itself enduringly ambiguous and a catalyst for all of Klossowski’s responses to Nietzsche, really be dismissed as merely a no-nonsense ‘thought experiment’? No spiritual revelation, no epiphanic moment, nothing to see here, move along please, move along? Carefully laid out on the paper, headed ‘Draft.’, and annotated with the remark ‘6000 feet above sea level and much higher above all human things! –’, the note has certainly encouraged religiously-minded readers of Nietzsche to propagate their worldviews from within Nietzsche’s own work.27 According to Klossowski, the 1881 note is not a draft of an embryonic theory, but rather the description of a lived experience:28
The Return of the Same.
Draft.
- The incarnation of the foundational errors.
- The incarnation of the passions.
- The incarnation29 of knowledge and of the knowledge that destroys. (Passion of Cognizing)
- The innocent one. The individual as experiment. The relieving of life, humiliation, weakening – transition.
- The new heavyweight: the eternal return of the same. Infinite importance of our knowledge, errors, of our habits, ways of life for all that will come. What shall we do with the rest of our life – we, who have spent the greatest part of the same in the most essential ignorance? We shall teach the doctrine [die Lehre] – it is the strongest means of incarnating it within ourselves. Our kind of beatitude, as teacher of the greatest teaching.
Start of August 1881 in Sils-Maria30

III. Epilogue: Walking Pollockshields with Fatima and Ishmael
As I write this article I’m conducting an online interview with a woman in her late twenties who I’m friends with and who grew up in Pollockshields. Although she, like me, enjoys going hiking and trekking, neither of us have yet tramped the alpine paths around Sils-Maria, to follow in Nietzsche’s footsteps. Leaving behind thoughts about the Eternal Return speaking to a myriad of unfulfilled wishes, whether for pakora or for Swiss hikes, I find myself back on a video call. Again.
Fatima is an engineer working in aeronautics in the south of England, who defines herself primarily as Scottish and, as a secondary attribute, as Muslim. Nonetheless she agrees to talk to me about her faith. She speaks about her less religious dad, whose greater concern has been to work hard in routine jobs to ensure that his kids get the good school and university education they have now received. She describes her more religious mum, with whom she has talked more about questions of religious observance, like the hijab her mum had wanted her to wear when she was a teenager. When Fatima made it clear she didn’t want to, neither her mum nor any other family member insisted on this dress code. As if feeling a duty to educate me on the basics, Fatima foregrounds Islam’s ‘five pillars’, which she learnt about attending Muslim ‘Sunday school’: the profession of faith, prayer, charitable giving, fasting during Ramadan, and the once in a lifetime Hajj, or pilgrimage to Mecca. Fatima explains that she hasn’t been on the Hajj yet, but she has been on the `Umrah, or lesser pilgrimage.
Like many other believers I speak to, theological questions are not Fatima’s big thing. From the outside, her life looks entirely secular: working hard, traveling the globe, spending time with both female and male friends, and able to play bass guitar. In this last regard, she’s unimpressed by the entreaties of the hyper-literalists. Muhammad ibn Adam al-Kawthari is a pro-caliphate cleric based in Leicester, England, who propagates a ban on both playing and listening to instruments, but this is hardly the kind of voice that Fatima is listening to.31 Considering such ascetic and irrationalist manifestations in Britain’s Muslim community, and experiencing Fatima as their opposite, a level-headed person who affirms life’s diversity, I ask if she can imagine anything that would make her give up her religion altogether? Pausing for an instant, she labels her childhood religious education matter-of-factly as ‘indoctrination’, and talks about how people internalise the same – that it’s nothing you can just shrug off. She doesn’t forget how Glasgow Sunnis, the grouping she belongs to, ensure that those who formally renounce their faith get the ‘right’ message: ‘you will burn forever in hell’. I don’t press Fatima on this – adults recalling the existential religious images stamped on them as children need some of this to stay private. But I get the sense that she neither believes in hellfire nor refuses to disbelieve in it entirely. Religion is bound tight to family, culture, geographical community: the things that co-define you while you become who you are. With no alternative philosophical or religious worldview on the horizon with a substance and a pull comparable to that which Islam exerts, why would individuals like Fatima risk exiling themselves from it?
Back in Glasgow in the summer, and with time to kill before my evening interview with the imam at the Dawat-E-Islami mosque on Niddrie Road, I go and wait in Queen’s Park, just to the south of Pollockshields. Under soaring church spires, groups sit on the freshly-cut grass and gear up for the weekend, drinking and smoking joints as the heat recedes. A bare-footed Glaswegian of middle-Eastern heritage is even walking around with a tamed but untethered parrot on his shoulder. I’ve never seen such a display in public. If he or his ancestors ever belonged to a ‘nay-saying religion’ he’s now saying yes to life so vigorously that you sense it could end dangerously. The North Sudanese barbers’ who I’d popped into for a trim on the way to the park were also full of patter,32 their self-professed Muslimness no barrier to treating life as a convivial and slowly-evolving party. When I get into the mosque the mood changes. Courteously, the Pakistani imam, Shafqad Mahmood, his assistant Mansoor Awais, who interprets for him when the English gets more complex, and a further elder male congregant, Haji Ahmad, have found half-an-hour or so for me at short notice, before evening prayers begin. My uneasiness is down to what I’ve read about the Dawat-E-Islami organisation in Ed Husain’s liberal Muslim critique of the current state of his religion in the UK. Translating as ‘Invitation to Islam’, the Pakistan-based group first opened mosques in the UK around 1995 and now, as the imam tells me proudly, they have three centres in the greater Glasgow area, catering for over five hundred believers weekly.33 Husain for his part discusses the sectarian murder, in 2016, of Asad Shah, less than a mile from where we’re sitting and talking, by ‘a Dawat-e-Islami man’: albeit one from Bradford in the north of England, and not by a fellow Glaswegian.34 Shah’s ‘offence’, at least in his killer’s eyes, was to be an Ahmadi, a follower of the Indian Ghulam Ahmad (1835-1908 CE) who claimed to be, concurrently, a ‘renewer of the faith’, ‘the promised messiah’, and ‘the mahdi (the rightly guided one who will appear at the end times together with the messiah)’: thus kickstarting a major new religious movement that is rejected uniformly by orthodox Muslims.35 As Husain had already interviewed a previous imam at the Queen’s Park mosque about Dawat-e-Islami and the 2016 murder, and had gotten evasive answers, I restrict myself to asking about the mosque’s attitudes to Shi’a, the Ahmadiya Muslim community, and other Muslim denominations. My overly orthodox question harvests a no-frills answer: ‘the Ahmadiya are not Muslims’. Surprisingly, Haji Ahmad adds that ‘we have Shi’a who come to pray here every week. Ahmadiya could even come and pray here if they wanted. If they didn’t say anything.’
Meant generously, the message is clear: mosque leaders tolerate non-standard beliefs only to the extent they remain utterly private. This strategy for ensuing conformity fits with what my question on the mosque’s attitude ‘to homosexual Muslims or to trans people?’ evinces: ‘We don’t accept them. But we wouldn’t say anything [if they came to pray at the mosque].’ I have to think of the story Fatima told me about a lesbian Muslim friend of hers trying to come out to her mother, and the friend’s mother being unable to embrace or support this reality. Hearing the story, you think the friend’s mother must have known long before about her daughter’s relationships – and tolerated them, as long as they remained hushed up.

No one is keeping quiet at the queer bookshop, Category is Books, just up the road from the Dawat-E-Islami mosque and religious school. Sadly I arrive outside opening hours, but the shop window is shouting out winning slogans to passers-by: ‘encourage lesbianism’, ‘better gay than grumpy’, ‘freedom of movement for all!’ and, in huge letters, the potentially game-changing ‘GET OFF THE INTERNET. DESTROY THE RIGHT WING.’ You’ll be forgiven for thinking that there is no dialogue between this shop’s community and that of the mosque. But the cause that has and will continue to generate dialogue arises when I ask the mosque’s leaders about the recipients of the organisation’s formal charitable status: ‘Over the last two years we’ve been funding aid deliveries via airplane into Gaza and the West Bank, food, water, and clothes, also looking after the orphans, no matter if the people there are Muslims, Christians or whatever.’ As the major British news platform The Canary reported recently, the group ‘No Pride in Genocide’ (Glasgow branch), ‘a broad coalition of LGBTQ+ Glaswegians’ demand of those running the city’s annual Pride march that they reject what Canary journalists call ‘companies directly profiting from Israel’s illegal occupation and ongoing genocide in Palestine.’36 If these concerns seem worlds removed from Nietzsche’s philosophical and Klossowski’s artistic hunches regarding Islam, we should turn to Judith Butler, surely the most widely-read philosopher of queerness of their generation, to see connections from them back to philosophy. Fighting back against Donald Trump’s Executive Order 14168 from January 2025, whose title makes its targets clear – ‘Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government’ – Butler joins up the dots on the common cause that trans people, Muslims, and other people of migrant heritage can find and are finding, in today’s polarised societies. Moreover, they [Butler] hone in on that group of trans people most vilified by the far Right: ‘people assigned male at birth who seek to transition [to a female or other gender identity]’.37 They point out that ‘presumption[s]’ about such men held by an increased number in society are unevidenced, and that the great majority of such men transition because ‘they hope for a more livable life’. Topping this, Butler argues that there is no philosophical justification for taking the ‘few recorded instances’ in which men have transitioned to ‘seek entry into women’s spaces in order, it is presumed, to harm the women there’ as a general ‘model for transition’. Extrapolating from here, and writing in the ‘first-person we’, Butler concludes:
We do not point to the nefarious actions of particular Jews or Muslims and conclude that all Jews or Muslims act in that way. No, we refuse to generalise on that basis, and we suspect that those who do so generalise are using the particular examples to ratify and amplify a form of hatred they already feel.38
Was Nietzsche being nefarious and intending harm by calling Islam ‘a yea-saying Semitic religion, spawned by the ruling classes’, then cementing this prejudice in favour of Islam over both Christianity and Judaism in print? – ‘Either one is a Chandala or one isn’t.’ If so, the remedy for such damage could be found in his more circumspect, more moderate and more ambiguously artistic successors. Whether you’ll find such successors on the streets of Glasgow’s Southside or in great artists, and latter-day Muslims, like Pierre Klossowski, will depend on the kind of cultural or religious home you’re looking for.
All pictures are photographs taken by the author. The title image shows a stone-mason’s yard on the edge of Pollockshields, offering bilingual gravestones for the district’s Muslim residents.
Bibliography
Albany, HRH Prince Michael of and Walid Amine Salhab, The Knights Templar of the Middle East: The Hidden History of the Islamic Origins of Freemasonry. Weiser Books: 2006.
Almond, Ian: ‘Nietzsche’s Peace with Islam: My Enemy’s Enemy is my Friend’, German Life and Letters 56, no. 1 (2003), 43-55.
Balthus (Count Balthazar Klossowski de Rola Balthus): Balthus in his Own Words: A Conversation with Cristina Carrillo de Albornoz. Assouline: 2002.
Balzani, Marzia, Ahmadiyya Islam and the Muslim Diaspora: Living at the End of Days. Routledge: 2020.
Barber, Malcolm: The New Knighthood: A History of the Order of the Temple. Cambridge University Press: 1994.
Bauer, Thomas: A Culture of Ambiguity: An Alternative History of Islam. Translated by Hinrich Biesterfeldt and Tricia Tunstall. Columbia University Press: 2021.
Butler, Judith: ‘This is Wrong: Judith Butler on Executive Order 14168’, London Review of Books, 3 April 2025, https://www.lrb.co.uk/the-paper/v47/n06/judith-butler/this-is-wrong, unnumbered.
Canary Journalists, The: ‘Glasgow Pride was just exposed as being complicit in Israel’s genocide’ in The Canary, 20 July 2025, unpaginated, https://www.thecanary.co/uk/news/2025/07/20/glasgow-pride-2025/.
Editors, various: Dictionaries of the Scots Language Online: 2025.
Groff, Peter: ‘Nietzsche and Islam’ [review of Nietzsche and Islam, by Roy Jackson], Philosophy East & West Volume 60, Number 3, July 2010, 430-437.
Husain, Ed: Among the Mosques: A Journey Around Muslim Britain. Bloomsbury: 2021.
Jackson, Roy: Nietzsche and Islam. Routledge: 2007.
Klossowski, Pierre: The Baphomet, translated by Sophie Hawkes and Stephen Sartarelli, with introductions by Juan Garcia Ponce and Michel Foucault. Eridanos Press: 1988.
Krokus, Christian: The Theology of Louis Massignon: Islam, Christ and the Church. Catholic University of America Press: 2017.
Newcomb, Tim (Translator and Editor of): Friedrich Nietzsche, Anti-Christian: The Curse of Christianity. Livraria Press: 2024.
Orsucci, Andrea. Orient-Okzident: Nietzsches Versuch einer Loslösung vom europäischen Weltbild. De Gruyter: 2011.
Smith Daniel: ‘Translator’s Preface’ in Pierre Klossowski, Nietzsche and the Vicious Circle, translated by Daniel Smith. University of Chicago Press: 1997, vii-xiii.
Sommer, Andreas Urs Sommer, Kommentar zu Nietzsches Der Antichrist, Ecce homo, Dionysos-Dithyramben, Nietzsche contra Wagner. De Gruyter: 2013.
Winter, Timothy: ‘Klossowski’s Reading of Nietzsche From an Islamic Viewpoint’, [Unpublished manuscript, shared by Winter with Henry Holland in October 2025, with a text similar but not identical to Winter’s lecture recorded for YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wC8YJfyOkOY], (2025).
Footnotes
1: Wellhausen, Reste arabischen Heidentums (1887), cited from Andreas Urs Sommer, Kommentar zu Nietzsches Der Antichrist, Ecce homo, Dionysos-Dithyramben, Nietzsche contra Wagner, 294-295. Sommer confirms Nietzsche was reading this work by Wellhausen in this period; see Sommer’s ‘Personenregister’, ibid., 920, for comprehensive references on Nietzsche’s reading of Wellhausen. Most translators continue to the follow the translation tradition established by Walter Kaufmann and others, and title their English works The Antichrist. Yet Tim Newcomb, author of one of the few translations to opt for The Anti-Christian as its title, is right to point out that Nietzsche’s primary target was Christians of his own age. Because ‘ein Christ’ translates as ‘a Christian’, deciding for the alternative title of The Anti-Christian is legitimate. Cf. Tim Newcomb, ‘Afterword’ in Friedrich Nietzsche, Anti-Christian: The Curse of Christianity.
2: Sommer, Kommentar zu Nietzsches Der Antichrist, 110.
3: All references to Manu / the Law Book of Manu in Nietzsche’s work, and to the related concept of Chandala, date to 1888. A letter to Heinrich Köselitz on 31 May 1888 (link) suggests he has just discovered this work: ‘I thank these last weeks for an essential lesson: I found the Legal Code of Manu in a French translation [presumably Louis Jacolliot’s], which was made in India under the precise control of the highest-ranked priests and scholars. This [is an] absolutely Aryan product, a priestly codex of morality on the foundation of the Vedas, the notion of castes, and ancient ancestry’. (Emphasis in the original.) This and the other translations from Nietzsche’s writings in this essay are the author’s own. For more on orientalist texts read by Nietzsche, cf. Ian Almond, ‘Nietzsche's Peace with Islam’, 43; and indeed for sufficient context, the whole text of: Andrea Orsucci, Orient-Okzident: Nietzsches Versuch einer Loslösung vom europaischen Weltbild.
4: Sommer, Kommentar zu Nietzsches Der Antichrist, 9 and 265.
5: Nachgelassene Fragmente 1888 14[95].
6: As Andreas Urs Sommer demonstrates, Nietzsche only inserted this cheap, anti-Semitic jibe into the final draft of this text: Sommer suggests this is Nietzsche playing to popular anti-Semitic sentiments among his potential readers. Cf. Sommer, Kommentar zu Nietzsches Der Antichrist, 298.
7: The Anti-Christian, § 60. There has been much recent scholarship on Friedrich II’s fondness for and proximity to Islam. On Nietzsche’s sources for the same subject, see Sommer, Kommentar zu Nietzsches Der Antichrist, 298-299, which also highlights the role played by August Müller’s writings on Friedrich II in Nietzsche’s reading. Müller recounts ‘as common knowledge […] how he [Friedrich II] took the most lively interest in the Arabs’ language and literature, pursued logic with his Muslim court philosophers, and even became half or even a whole heathen [i.e., a Muslim] himself, thus scandalising all pious people’. (Cited from Sommer, Kommentar zu Nietzsches Der Antichrist, 298.)
9: Summary of the position argued by Jackson as given by: Peter Groff, ‘Nietzsche and Islam’, 431.
10: Roy Jackson, Nietzsche and Islam, e-book-location: chapter 1, location 7.51.
11: Groff, 435. Groff considers The Joyous Science, §346 as one of Nietzsche’s clearest statements about ‘going beyond atheism’. Here Nietzsche writes: ‘If we wanted simply to name ourselves with an older expression like godless or unbelievers or even immoralists, we would still believe ourselves to be far from described by such epithets’.
12: Groff, 430.
13: Cf. ibid. 431; and Jackson, Nietzsche, chapter 2, 8.46-8.50.
14: Beyond Good and Evil, § 12.
15: Summary of Jackson’s argument given in Groff, ‘Nietzsche and Islam’, 432.
16: For a well-researched historical summary of such viewpoints, see Malcom Barber, The New Knighthood, 321. For an Islamophile account of the same history that is open to conspiracist thinking, see HRH Prince Michael of Albany and Walid Amine Salhab, The Knights Templar of the Middle East: The Hidden History of the Islamic Origins of Freemasonry, x-xi and 22-23.
17: Thomas Bauer, A Culture of Ambiguity: An Alternative History of Islam, 11, cited from Timothy Winter’s unpublished manuscript ‘Klossowski’s reading of Nietzsche from an Islamic viewpoint’, 1, which Winter generously shared with me in October 2025. I thank Winter heartily for his colleaguiality in sharing this book in progress with me at this stage. The text of Winter’s manuscript is mostly identical to his aforementioned YouTube lecture, but includes some minor changes.
18: Klossowski, The Baphomet, xv.
19: Winter, unpublished manuscript ‘Klossowski’s reading of Nietzsche from an Islamic viewpoint’, 8.
20: Pierre Klossowski, ‘Notes and Explanations’ in The Baphomet, 166-167.
21: Daybreak, § 109.
22: Italics my own. Klossowski, Baphomet, 111.
23: Ibid., 112.
24: Ibid., 125.
25: Winter, ‘Klossowski’s reading’, 10. Klossowski’s conversion is ambiguous in the sense that is recorded in a single, terse passage by his younger brother, Balthus: ‘My brother, Pierre, became a Dominican monk when he was young. Then, a lot later, he converted to Islam.’ Cited in: Balthus (Count Balthazar Klossowski de Rola Balthus), Balthus in his Own Words, 11. There is no reason to question Balthus’s account just because it’s terse: we could instead conclude that Klossowski’s Muslimness was a mostly private affair. Relevantly, this is not the only conversion in Klossowski’s life that Balthus describes: ‘[Adam-Maxwell Reweski] left my brother and me a sum of money that we could use for our education if we became Catholics. And we did convert to Catholicism, whereas my father was a Protestant.’ Ibid., 5.
26: Christian Krokus, The Theology of Louis Massignon, 175; cited in Winter, ‘Klossowski’s Reading of Nietzsche’, 11.
27: Nachgelassene Fragmente 1881 11[141].
28: See for example, the paper ‘entitled “Forgetting and Anamnesis in the Lived Experience of the Eternal Return of the Same”, which Klossowski presented at the famous Royaumont conference on Nietzsche in July 1964’, as described in Daniel Smith, ‘Translator’s Preface’, viii.
29: While the noun Einverleibung used in points 1 to 3 of this note could also be translated as ‘embodiment’ or even, more weakly and figuratively, as ‘incorporation’, disputing ‘incarnation’ as one valid translation makes no etymological sense. ‘Incarnation’ derives the from Late Latin incarnationem (nominative incarnatio), ‘act of being made flesh’ or entering into a body, while ‘embodiment’ in English also refers back primarily to the ‘embodiment of God in the person of Christ’, i.e., to the Old French incarnacion ‘the Incarnation’ (12th century C.E.). ‘Einverleibung’ in German carries strong Christian connotations, of which Nietzsche was evidently aware, just as ‘incarnation’ does in English.
30: Nachgelassene Fragmente 1881 11[141].
31: Al-Kawthari cited from Ed Husain, Among the Mosques, chapter 1.
32: Scottish English, patter: ‘A person’s line in conversation. This can mean ordinary chatting, as in “Sit doon an gie’s aw yer patter”; it can also mean talk intended to amuse or impress, as in “He’s got some patter that pal a yours”’. Cited from the Dictionaries of the Scots Language, https://www.dsl.ac.uk/entry/snd/sndns2837.
33: Dawat-e-Islami is estimated to own and run around forty properties in the UK as a whole.
34: For details of Shah’s murder and the theological role played by Dawat-e-Islami in it, see: Ed Husain, Among the Mosques, in the Glasgow section of chapter 8, ‘Edinburgh and Glasgow’.
35: Marzia Balzani, Ahmadiyya Islam and the Muslim Diaspora, 2.
36: The Canary Journalists, ‘Glasgow Pride was just exposed as being complicit in Israel’s genocide’ 20 July 2025, unpaginated.
37: Judith Butler, ‘This is Wrong: Judith Butler on Executive Order 14168’, unnumbered.
38:This and the previous citations taken from Butler, ibid., unnumbered.
“Peace with Islam?”
Hiking with Nietzsche Through Glasgow’s Muslim Southside: Part II
In the second part of his article on hiking through Glasgow’s Muslim-esque Southside, our staff writer Henry Holland delves into Nietzsche’s impassioned yet scattergun engagement with the youngest Abrahamic religion. He investigates how the experimental novel The Baphomet by French artist and theoretician Pierre Klossowski – which got him hooked on the Islam-Nietzsche intersection in the first place – blends Islam-inspired mysticism, sexual transgression and Nietzscheanism itself into an inimitable potion. With insights on Muslim-esque readings of Nietzsche in tow, Holland returns with Fatima and Ishmael to Scotland’s largest city, thus wrapping up his travelogue whence it began.
Fascinated by the Machine
Nietzsche's Reevaluation of the Machine Metaphor in His Late Work
Fascinated by the Machine
Nietzsche‘s Reevaluation of the Machine Metaphor in His Late Work


Last week, Emma Schunack reported on this year's annual meeting of the Nietzsche Society on the topic Nietzsche's technologies (link). In addition, in his article this week, Paul Stephan explores how Nietzsche uses the machine as a metaphor. The findings of his philological deep drilling through Nietzsche's writings: While in his early writings he builds on Romantic machine criticism and describes the machine as a threat to humanity and authenticity, from 1875, initially in his letters, a surprising turn takes place. Even though Nietzsche still occasionally builds on the old opposition of man and machine, he now initially describes himself as a machine and finally even advocates a fusion up to the identification of subject and apparatus, thinks becoming oneself as becoming a machine. This is due to Nietzsche's gradual general departure from the humanist ideals of his early and middle creative period and the increasing “obscuration” of his thinking — not least the discovery of the idea of “eternal return.” A critique of the capitalist social machine becomes its radical affirmation — amor fati as amor machinae.
Nietzsche's cultural criticism is extremely ambivalent in its orientation towards modernity. Sometimes it seems as if he represents an almost modernist point of view, sometimes he tends towards the Romantic or even the reactionary. In order to visualize this ambiguity of Nietzsche's cultural criticism and his position on modernity, it is extremely instructive to look at his statements on the term “machine.” This allows, not least, a more nuanced view of his ethics of authenticity.
I. A Fighter against Machine Time
Statements in which he criticizes the machine and uses it as a metaphor for modern capitalism run like a common thread throughout Nietzsche's work from the earliest to the latest writings. He criticizes, for example, that the modern “external academic apparatus, [...] the educational machine of the university put into action.”1 Reduce scholars to mere machines like factory workers.2 Modern philosophers are “machines of thinking, writing and speaking”3. In a similar way to Karl Marx, Nietzsche even criticizes the subjugation of workers in this period, who are forced to “rent themselves out as physical machines.”4, himself under the machinery and blames them for their moral degeneration or for the sprouting of what he would later call “resentment”:
The machine terribly controls that everything is happening at the right time and in the right way. The worker obeys the blind despot; he is more than his slave. The machine Does not educate the will to self-control. It awakens a desire to react to despotism — debauchery, nonsense, intoxication. The machine evokes Saturnalia.5
Elsewhere, Nietzsche formulates the dialectic of machinization as follows:
Reaction against machine culture. — The machine, itself a product of the highest thinking power, sets in motion almost only the lower thoughtless forces of the people who operate it. In doing so, it unleashes an immense amount of power that would otherwise lie asleep, that is true; but it does not give the impetus to climb higher, to improve, to become an artist. She makes Acting and monoform, — in the long run, however, this creates a countereffect, a desperate boredom of the soul, which learns to thirst for varied idleness through it.6
Machinery thus serves as an educator of inauthenticity, producing flexible machine people who are unable to educate themselves:
The wild animals should learn to look away from themselves and try to live in others (or God), forgetting themselves as much as possible! They feel better that way! Our moral tendency is still that of wild animals! They should become tools of large machines besides them and would rather turn the wheel than be with themselves. Morality has been a challenge so far Not to deal with yourselfby shifting your mind and stealing time, time and energy. Working yourself down, tiring yourself, wearing the yoke under the concept of duty or fear of hell — great slave labor was morality: with the fear of the ego.7
Even in his late work, Nietzsche considered submission to the “tremendous machinery”8 of the “so-called 'civilization'” (ibid.) — its main features: “the reduction, the ability to pain, the restlessness, the haste, the hustle and bustle” (ibid.) — as the main reason for “the The rise of pessimism“(ibid.). He speaks disparagingly of the arbitrarily fungible “small [n] machines”9 of modern scholars and ridicules the fact that it is the task of the modern “higher education system”10 Be, “[a] us to make a machine for man” (ibid.), a dutiful “state official” (ibid.) as a, supposed, complete manifestation of Kant's ethics. When viewed honestly
That wasteful and disastrous period of the Renaissance turns out to be the last large time, and we, we modernity with our fearful self-care and charity, with our virtues of work, unpretentiousness, legality, scientificity — collecting, economic, machinal — as a faint Time [.]11
And last but not least, he speaks in Ecce homo about the “treatment I receive from my mother and sister”12 as a “perfect [r] hell machine” (ibid.).
The estate of the early 1870s even states programmatically:
handicraft learning, the necessary return of the person in need of education to the smallest circle, which he idealizes as much as possible. Combating the abstract production of machines and factories. To create ridicule and hate against what is now considered “education”: by opposing more mature education.13
The modern utilitarian machine world is Nietzsche in its totality a horror, which he critically confronts with the Dionysian culture of antiquity:
Antiquity is in its entirety the age of talent for Festfreude. The thousand reasons to rejoice were not discovered without acumen and great thought; a good part of the brain activity, which is now focused on the invention of machines, on solving scientific problems, was aimed at increasing sources of joy: the feeling, the effect should be turned into something pleasant, we change the causes of suffering, we are prophylactic [precautionary; PS], that palliative [“wrapping in the sense of palliative care; PS].14
In the machine world, people surround themselves with anonymous goods instead of real things, through which they could enter into a resonating relationship with their originators:
How does the machine humble. — The machine is impersonal, it deprives the piece of work of its pride, its individual Good and faulty, which sticks to all non-machine work — that is, its bit of humanity. In the past, everything buying from artisans was a Marking people, with whose badge you surrounded yourself: the household and clothing thus became a symbol of mutual appreciation and personal belonging, while now we only seem to live in the midst of anonymous and impersonal sclaventhum. — You don't have to buy the ease of work.15
In contrast to personally manufactured, authentic, artisanal products, the mechanical goods did not impress with their intrinsic quality, as could only be determined by experts, but only through their effect and thus deceive the general public.16
However, Nietzsche summarizes this comprehensive critique of modern commodity production and the world of life bewitched by it most harshly in Human, all-too-human together:
Thought of Discontent. — People are like coal mines in the forest. Only when young people have burned out and are charred, like them, will they usefully. As long as they steam and smoke, they may be more interesting, but useless and even too often uncomfortable. — Humanity mercilessly uses each individual as material to heat its large machines: but why use the machines when all individuals (i.e. humanity) only use them to maintain them? Machines that are their own purpose — is that the umana commedia [human comedy; PS]?17
The proximity of these ideas to a Rousseauist, romantic critique of capitalism, but also to Marx, is remarkable and obvious. For Nietzsche, the “machine” becomes the epitome of what Marxism describes as the “fetishism of commodity production” and he comes surprisingly close to a clear understanding of the rederizing mechanisms of the capitalist mode of production here. — Of course, this metaphor is not astonishing in view of the fact that the valorization of “authentic production” over craft into the “absolute metaphors” (Hans Blumenberg) of modern thinking of authenticity On whose tracks Nietzsche moves completely at these points. The living and the dead, the machine and real practice, are juxtaposed in a harsh dualistic way.18
In view of these clear words, it is significant that, in parallel, there was an almost diametral revaluation of the machine in Nietzsche's writings from around 1875.
II. Man as a Machine
Remarkably, this first takes place in Nietzsche's letters. Between 1875 and 1888, he repeatedly referred to his own body or even himself as a “machine” in them and reported on their good or poor functioning.19 In this sense, he already speaks in the Morgenröthe in a purely descriptive sense of the body in general as a machine20 and is also moving on to calling humanity as such in a neutral way.21 Here he apparently draws on the naturalistic wing of the Enlightenment, such as Julien Offray de La Mettries L'homme machine (Man as a machine, 1748), as part of his generally growing interest in naturalistic explanations of human behavior in that period.
Already in Human, all-too-human Nietzsche admiringly compares Greek culture with a speeding machine whose tremendous speed made it susceptible to the slightest disturbances.22 In the estate of the 1880s, Nietzsche then just as uncritically designed a “depiction of the machine 'man'”23 and moves on to seeing something good in the machinization of humanity:
The need to prove that to an ever more economic consumption of people and humanity, to an ever more closely intertwined “machinery” of interests and services A countermovement belongs. I refer to the same as Elimination of humanity's luxury surplus: It should bring to light a stronger species, a higher type, which has different conditions of origin and conservation than the average human being. My term, my allegory For this type, [...] is the word “superman.”
That first path [...] results in adaptation, flattening out, higher Chineseness, instinct modesty, satisfaction in reducing people — a kind of stoppage in Human level. Once we have the unavoidably imminent overall economic administration of the earth, then humanity can find its best meaning as machinery at its service: as a tremendous train of ever smaller, ever finer “adapted” wheels; as an ever increasing superfluence of all dominant and commanding elements; as a whole of tremendous power whose individual factors Minimal powers, minimal values represent. In contrast to this reduction and adaptation of the M <enschen>to a more specialized utility, the reverse movement is required — the generation of synthetic, of buzzing, ofthe justifying People for whom this machinalization of humanity is a precondition of existence, as a base on which he can his Higher form of being Can invent yourself...
He just as much needs the antagonism the crowd, the “leveled”, the sense of distance compared to them; he likes them, he lives from them. This higher form of aristocratism is that of the future. — Morally speaking, that overall machinery, the solidarity of all wheels, represents a maximum in the Exploitation of humans represents: but it presupposes those for whose reason this exploitation sense has. Otherwise, it would in fact simply be the overall reduction Werth-Reduction of the type human, — a decline phenomenon in the biggest style.
[...] [W] As I fight, is he economic Optimism: as if with the growing expenses Aller The benefits of all should also necessarily grow. The opposite seems to me to be the case: Everyone's expenses add up to a total loss: the human being becomes lesser: — so that you no longer know what this tremendous process was for in the first place. One for what? one new “What for! “— that is what humanity needs...24
In line with the idea of a — hoped-for — transformation of levelling into a new aristocracy, which has also been repeatedly discussed in the published work25 Although Nietzsche now adheres to his earlier critique of maschization, he also hopes that she will at the same time give birth to a new class of “supermen,” who will dominate the “army” of the machine of completely subjugated slaves. In antichrist He clearly states this political 'utopia' and explains it naturalistically: “That you are a public benefit, a wheel, a function, there is also a determination of nature: not the society, the species luck, which the vast majority are only capable of, turn them into intelligent machines.”26.
Is there already in Human, all-too-human aphorisms in which submission to the machine is described not apologetically, but also not critically, but purely descriptively as a “pedagogy,”27 Is he now increasingly going about recommending this subordination, even in the case of scholars, as a healing method against resentment28 and sees the early scene of the civilizational formation of humanity in the machinization of large parts of humanity by a small “caste” of brutal “predator people.”29
III. The Genius as an Apparatus?
But Nietzsche's fascination for machines does not stop there. Although he speaks himself in the Happy science against understanding the entirety of being as a machine, but not because this would mean devaluation or reification, on the contrary: “Let us beware of believing that the universe is a machine; it is certainly not based on a goal, we honor it far too much with the word 'machine'”30. Nietzsche, on the other hand, describes the human intellect completely uncritically as a machine in the same book31 And in the same way, human soul life as a whole should now be understood as a machine32. This applies, of all things, to the “genius”, which has been glorified since early work as the epitome of the highest authentic selfhood, which Nietzsche used from Morgenröthe compare with a machine over and over again.33 He speaks in the Götzen-Dämmerung, with none other than Julius Caesar as an example, even of “that subtle machine working under extreme pressure that is called genius.”34 and in a late estate fragment of him as the “most sublime machine [s] that exists”35.
The modern “rape of nature with the help of machines and the so harmless technical and engineering ingenuity”36 now celebrates Nietzsche as “power and sense of power [...] [,] hubris and godlessness” (ibid.) and therefore as an antithesis to modern decadence.37 An estate fragment from 1887 even states:
The task is to <zu>make people as usable as possible and to get them closer to the infallible machine as far as possible: for this purpose, he must work with Machine virtues be equipped (— he must learn to perceive the states in which he works in a machine-usable manner as the most valuable: it is necessary that the others be stripped as far as possible, as dangerous and disgusted as possible...)
Here is the first stumbling block boredom, the uniformity, which involves all mechanical activities. This Learning to endure and not just endure, learning to see boredom played around by a higher stimulus [.] [...] Such an existence requires philosophical justification and transfiguration more than any other: the pleasant Emotions must be discounted as lower rank by some infallible authority at all; the “duty itself,” perhaps even the pathos of reverence in regard to everything that is unpleasant — and this requirement as speaking beyond all usefulness, deliriousness, expediency, imperativity... The machinal form of existence as the highest most venerable form of existence, worshipping oneself.38
The revaluation is thus finally complete: It is no longer just a matter of creating a slave status of “machine people” with a sense of “advancement” of the species, which is confronted by a small group of “authentic” leaders, but all people should act equally as cogs of a large overall machine whose process is affirmed as an end in itself. In fact, only a distinction can be made between people who are cogs and those who form self-contained machines and are therefore destined to rule. Self-development as machinization.
Nietzsche thus becomes a pioneer of cybernetic techno-fascism, as Ernst Jünger had already foreseen on the eve of the “seizure of power” as a possible alternative to liberal humanism39 and today in “avant-garde fascist” circles40 again In vogue is, but also the post-modernist transfiguration of “becoming a machine” as a supposed subversive practice, as promoted tirelessly by Gilles Deleuze and Félix Guattari. The utopia of the flexible person as a “cyborg”41. It is almost funny that both the critical and the affirmative use of the machine metaphor apply equally in Nietzsche's last writings and testifies to the conflict of his thinking and his subjective indecision.
If you combine this last turn in Nietzsche's thinking with the concept of “eternal return,” which finds its tangible counterpart in the endless circle of machinery,42 Even though Nietzsche himself does not attempt this parallel, this analysis reveals the deeper reason for Nietzsche's “waste”: The growing insight into the structural dynamics of modern societies made him (ver) doubt more and more the possibility of realizing their authenticity. Not least because — as his letters mentioned above testify, which are probably not by chance at the very beginning of his “return” from machine striker to admirer — he recognized that the machinization of the world is not just an external skill, but an internal event from which one is subjectively unable to escape. Authenticity could then only be realized as a continuous fight against oneself. Dissatisfied with this, Nietzsche is now striving to radically affirm the machinization of the world mythologized as the “eternal return.” An affirmation which, however, like the talk of “hell machine” in Ecce homo underlines that it could only be successful at the price of complete self-abandonment, since its essence — as early Nietzsche recognized so clearly — is a misanthropic process which forces people to affirm something that, other than delusional, cannot be affirmed.
The obvious way out would be precisely to take on this fight against internal and external machinization — both in the sense of individual heroism and in the sense of political “machine-storming” — and to endure the internal conflict that the modern world of life imposes on people. But this is precisely where Nietzsche fails; he — contrary to what he himself called for — cannot maintain this tension, must “bridge” the “arc” of his ethics of authenticity43 with the help of his mythological constructions, which became ever more grotesque, ever more out of touch with reality in his late work. The real challenge that the ideal of authenticity poses to individuals is therefore to maintain one's own authenticity in a society dominated by inauthenticity without going crazy or succumbing to the conformist temptation of flexibility.
Literature
Benjamin, Walter: One way street. Frankfurt am Main 1955.
Ders. : Central Park. In: illuminations. Selected fonts. Frankfurt am Main 1977, pp. 230—250.
Haraway, Donna: A Cyborg Manifesto. In: Socialist Review 80 (1985), PP. 65—108.
Younger, Ernst: The worker. Domination and Form. Stuttgart 2022.
Stephen, Paul: Modernity as a culture of violence. Nietzsche as a critic of violence. In: Engagée. political-philosophical interventions 4 (2016), P. 20-23.
Footnotes
1: About the future of our educational institutions, Lecture V.
2: See, for example, ibid. and ibid., Speech I.
3: The benefits and disadvantages of history for life, paragraph 5. See also Schopenhauer as an educator, paragraph 3.
4: Subsequent fragments No. 1880 2 [62].
5: Subsequent fragments No. 1879 40 [4].
6: Human, all-too-human Vol. II, The Wanderer and His Shadow, Aph 220.
7: Subsequent fragments No. 1880 6 [104].
8: Subsequent fragments No. 1887 9 [162].
9: Beyond good and evil, Aph 6.
10: Götzen-Dämmerung, rambles, Aph 29.
11: Ibid., Aph 37.
12: Ecce homo, Why I'm so wise, paragraph 3.
13: Subsequent fragments No. 1873 29 [195].
14: Subsequent fragments No. 1876 23 [148].
15: Human, all-too-human Vol. II, The Wanderer and His Shadow, Aph 220.
16: Cf. Ibid., aph. 280.
17: Human, all-too-human, Vol. I, Aph. 585.
18: In this phase, Nietzsche even decisively expresses understanding for the workers' displeasure and recommends to them his ethics of authenticity as a way out of the dilemma “either a slave of the state or the slave of an overthrow party becomes must“(Morgenröthe, Aph 206). During this time, such mind games brought him remarkably close to anarchism (see e.g. Morgenröthe, Aph 179).
19: Cf. Bf. to Carl von Gersdorff v. 8/5/1875, No. 443; Bf. to dens. v. 26.6.1875, No. 457; Bf. to Elisabeth Förster-Nietzsche v. 30.5.1879, No. 849; Bf. to Heinrich Köselitz v. 14/8/1881, No. 136; Bf. to Franz Overbeck v. 31/12/1882, No. 366; Bf. to Malwida von Meysenbug v. 1/2/1883, No. 371; Bf. to Heinrich Köselitz v. 19/11/1886, No. 776; Bf. to Franziska Nietzsche v. 5.3.1888, No. 1003 and Bf. to Franz Overbeck v. 4/7/1888, No. 1056. It turns out that Nietzsche does not write these letters to “anyone,” but to his most intimate “small circle.” Nietzsche wrote to Overbeck on 14/11/1886: “The antinomy My current situation and form of existence now lies in the fact that everything that I as philosophus radicalis Nöthig Have — freedom from work, wife, child, society, fatherland, faith, etc., etc. I as many deprivations I feel that I am happily a living being and not just an analytical machine and an objectifying device” (No 775). A letter to Heinrich Romundt dated 15/4/1876 is also remarkable, which states: “I never know where I am actually more ill once I am ill, whether as a machine or as a machinist” (No 521).
20: Cf. Aph 86.
21: Cf. Subsequent fragments No. 1876 21 [11].
22: Cf. Human, all-too-human Vol. I, Aph 261.
23: Subsequent fragments No. 1884 25 [136].
24: Subsequent fragments No. 1887 10 [17].
25: See e.g. Beyond good and evil, Aph 242.
26: Paragraph 57.
27: Cf. Vol. I, Aph. 593 and Vol. II, The Wanderer and His Shadow, 218.
28: Cf. Subsequent fragments 1881 11 [31] and On the genealogy of morality, paragraph III, 18.
29: Cf. ibid., para. II, 17.
30: Aph 109.
31: Cf. Aph 6 and Paragraph 327.
32: Cf. Subsequent fragments No. 1885 2 [113] and The Antichrist, paragraph 14.
33: Cf. Morgenröthe, Aph 538; Götzen-Dämmerung, rambles, Aph 8 and The Wagner Case, paragraph 5.
34: rambles, Aph 31.
35: Subsequent fragments No. 1888 14 [133].
36: On the genealogy of morality, paragraph III, 9.
37: This passage is one of the most ambiguous in Nietzsche's work. At first glance, it makes sense to regard them as a critique of modern science and technology (see also my own essay on this subject Modernity as a Culture of Violence). But the late Nietzsche does not use “power” and even “rape” in any critical sense at all, as he keeps in the genealogy Clearly stated elsewhere:”[A] n yourself Of course, injuring, raping, exploiting, destroying cannot be anything “wrong”, insofar as life essential, namely hurtful, raping, exploitative, destructive in its basic functions and cannot be thought of at all without this character” (para. II, 11). And in the passage itself, it says: “[S] elbst still measured with the measures of the ancient Greeks, our entire modern being, insofar as it is not weakness but power and sense of power, looks like pure hubris and godlessness.” If one assumes that Nietzsche still refers positively to the “ancient Greeks” and their ethics of “measure,” this sentence should be read critically — but it is also obvious to understand it as meaning that in the described aspects of modernity, Nietzsche sees just the opposite of the “masterly moral” features of modernity that oppose their general nihilism. What objection should the declared “Antichrist” have against “ungodliness”?
38: Subsequent fragments No. 1887 10 [11].
39: Cf. The worker.
40: Just think of the corresponding visions of billionaires Elon Musk and Peter Thiel.
41: See, for example, Donna Haraway, A Cyborg Manifesto.
42: Walter Benjamin already recognized this connection between “eternal return” and the cyclicity of the capitalist economy (cf. One way street, P. 63 & Central Park, PP. 241—246).
43: Cf. Beyond good and evil, Preface.
Fascinated by the Machine
Nietzsche‘s Reevaluation of the Machine Metaphor in His Late Work
Last week, Emma Schunack reported on this year's annual meeting of the Nietzsche Society on the topic Nietzsche's technologies (link). In addition, in his article this week, Paul Stephan explores how Nietzsche uses the machine as a metaphor. The findings of his philological deep drilling through Nietzsche's writings: While in his early writings he builds on Romantic machine criticism and describes the machine as a threat to humanity and authenticity, from 1875, initially in his letters, a surprising turn takes place. Even though Nietzsche still occasionally builds on the old opposition of man and machine, he now initially describes himself as a machine and finally even advocates a fusion up to the identification of subject and apparatus, thinks becoming oneself as becoming a machine. This is due to Nietzsche's gradual general departure from the humanist ideals of his early and middle creative period and the increasing “obscuration” of his thinking — not least the discovery of the idea of “eternal return.” A critique of the capitalist social machine becomes its radical affirmation — amor fati as amor machinae.
Nietzsche and Cyborgs
The International Nietzsche Congress 2025
Nietzsche and Cyborgs
The International Nietzsche Congress 2025


Under the topic Nietzsche's technologies international visitors were once again invited to the Nietzsche Society conference in Naumburg an der Saale this year. In the period from October 16 to 19, in addition to various lectures, a film screening and a concert, there was also an art exhibition to visit. Our author Emma Schunack was there and reports on her impressions. Her question: How can Nietzsche's technologies find expression in the technological age?
Editorial note: The conference report does not mention the important “Lectio Nietzscheana Naumburgensis,” with which Werner Stegmaier rounded off the conference on Sunday morning and took up the topic of the conference again in a completely different way by asking about Nietzsche's own “philosophizing techniques.” We have now published this important talk in full length with the kind permission of the author (link).
Friedrich Nietzsche himself spent many years of his childhood and youth in the city on the Saale. His family home still stands today in the vineyard 18. In 2008, the Friedrich Nietzsche Foundation Naumburg was founded here, which operates the Nietzsche Documentation Center as a publicly accessible research and cultural center, which once again serves as the venue for the Nietzsche Congress this year.
If you get to the Congress from the train station, you first come across the former Nietzsche family home. A winding house surrounded by wine, the ground floor of which is now a small bookshop with a selection of Nietzsche's writings. If you go just a few steps further, the Documentation Center is located right next to the historic Nietzsche House as a modern new building with bright walls and large window fronts. Inside the building, there are light-filled rooms on three floors, which provide space for a library, an archive, two exhibition areas and two plenary rooms. There are Nietzsche busts in the corridors, and large lettering with quotes from the philosopher is repeatedly affixed to walls and stairs.
The conference, chaired by Edgar Landgraf, Catarina Caetano da Rosa and Johann Szews, starts on Thursday afternoon with various greetings, including from the Director of the Friedrich Nietzsche Foundation, Andreas Urs Sommer, and the Chairman of the Nietzsche Society e.V., Marco Brusotti. The talks given this weekend on Nietzsche's technologies are divided into various sections, from “Cultural and Body Techniques”, “Nineteenth-Century Techniques” and “Anthropo and Media Techniques” to “Techniques of Discipline and Subjectification” to “Linguistic and Rhetorical Techniques.” In this way, the term technology is broadly defined and provides a basis for various interpretations.

I. Human Thinking as a Technique
What mental techniques must humans practice in order to think like Nietzsche? Emanuel Seitz, research assistant at the University of Basel, will address this question and its implications in his presentation Nietzsche, a stoic of intoxication. The techniques of a mental exercise. Seitz is primarily concerned with the questions: What do I have to do to become Nietzsche? Can Nietzsche be described as a Stoic? To answer this question, Seitz first explains three techniques for the Stoa's spiritual reflection: the practice of thinking, desire and drive. It should be possible to learn those exercises or techniques. They aim to form an appropriate idea of the true value of things through reflection. With the help of the exercises, humans should reach value judgments that are not just subjective, they should practice distance and look down from the universe like God. Practicing these techniques of thinking creates a kind of cosmic consciousness, as the Stoa teaches, which leads to a new form of freedom of judgment. It is only by practicing these exercises that people are able to reevaluate existing values.
Seitz combines these Stoa exercises with Nietzsche's own practice The technique of philosophy as an art of living, It is about action, not knowledge, According to Seitz. He argues that although Nietzsche comes to completely different results than the Stoa, not to a humanist ideal of compassion, but to self-discipline and selfishness as a passion. Although Nietzsche despises moralism, he deals with questions about The will for cosmic justice. Seitz therefore argues that Nietzsche could very well be described as a Stoic in terms of the method of his thinking, in complete contrast to the content of his philosophy. In conclusion, he therefore expressly pleads for Nietzsche to be taken seriously as a technician of thought.

II. Post-humanist Perspectives on Nietzsche
In line with this year's theme of the congress, some of the lectures relate to post-humanist epistemology and Science and Technology Studies. Babeth Nora Roger-Vasselin places particular focus on post-humanist positions, who in her presentation Incorporation out of business. Incorporation seen as a technique Nietzsche's concept of incorporation attempts to combine with the figure of a cyborg after Donna Haraway.
Roger-Vasselin regards Nietzsche's concept of incorporation as a technique of individuation. This is what incorporation describes as an organism actively simulates its sensory experience, a formative process that all living beings share. Roger-Vasselin describes this process of incorporation as technique, since it is not natural or innate to us, it is instead the result of education based on individuation. With this technique These are standardized processes through forms and rhythms.
But what could that technique of incorporation look like in the technological age? Roger-Vasselin argues in this context using the figure of the cyborg and refers to Donna Haraway. The cyborg is described by Haraway as “a cybernetic organism, a hybrid of machine and organism, a product of both social reality and imagination.”1, a creature that is neither natural nor artificial, but both at the same time and nothing alone2. For Haraway, cybernetic organisms are neither nature nor culture, but have always been natural culture3. Conceptually, with the figure of the cyborg, Haraway blurs supposed boundaries between humans, animals and machines and establishes a way of thinking of difference beyond dualisms4: “To be one is always to become together with many”5. And so Roger-Vasselin argues that community forms in the technological age should be collectives of cyborgs.
Matthäus Leidenfrost presents another post-humanist perspective on Nietzsche in his presentation Animal husbandry and human taming. Nietzsche on anthropotechnical practices, In which he deals with the relationship between animals, humans and technology in Nietzsche. He discusses how Nietzsche himself described humans as a sick animal that has been tamed with the tools of culture and hides behind clothing and morals. According to Nietzsche, humans living in the flock are deficient and deprived of their own investments. In this way, people themselves suffer from life. At this point, Leidenfrost is referring to Peter Sloterdijk, who, in this context, formulates an invitation to people to recognize their own animality and to become part of an open bio-cultural existence. Illness is not a rigid state here, it is decay, but also recognition and a new beginning, an opportunity for growth. Leidenfrost continues to refer to current trans- and post-humanist discourses and he too refers to Donna Haraway at this point. He reads Nietzsche's reflections in this regard as an invitation to humans to open themselves up in an affective dimension in the age of perfection and within their own domestication of their own animality, in the spirit of the end of So Zarathustra spoke: “He denied and brewed all their virtues from the wildest, bravest animals; only then did he become — a human being. ”6

III. Aesthetic Experience
In addition to scientific lectures, the congress also offered aesthetic approaches to Nietzsche's thinking. This is how the exhibition was Nietzsche's Echo. Pictures of contradictions opened by painter Conny Gabora. The works shown are inspired by Nietzsche and his thoughts and life conflicts. They are intended to represent an artistic homage to the philosopher. In addition, the German film premiere of Nietzsche's landscapes in the Upper Engadine by Fabien Jégoudez and on Saturday evening, pianist Silvia Heyder and singer Julia Preußler gave a concert at which they performed some selected from Nietzsche's compositions. We were thus able to express Nietzsche's thinking not only in scientific form, but also in aesthetic experience.
IV. Conclusion
How can Nietzsche's technologies find expression in the technological age? The Congress in Naumburg has shown how Nietzsche can be read today as a technician of thought, a philosophy of doing, not of mere knowledge. This thinking provides the basis for a view of humans as a being that recognizes their animality and their integrations and enrolls itself in collectives of cyborgs and in the open biocultural network of being: “We are all chimeras, theorized and manufactured hybrids of machines and organisms; in a word, we are cyborgs.”7.
The photographs are by the author. The article image shows a Nietzsche bust by Fritz Rogge from 1943 on the first floor of the Nietzsche Documentation Center.
Literature
Fink, Dagmar: Becoming a cyborg: Possibility horizons in feminist theories and science fiction. Gender Studies. Transcript Verlag.
Haraway, Donna: The encounter of species. In: Texts on animal theory, published by Roland Borgards, Esther Köhring and Alexander Kling. Reclam's universal library, No. 19178. Reclam.
Haraway, Donna: Manifestly Haraway. Posthumanities 37th University of Minnesota Press.
Footnotes
1: “[A] cybernetic organism, a hybrid of machine and organism, a creature of social reality as well as a creature of fiction” (Haraway, Manifestly Haraway, p. 5; translation by the editor).
2: Cf. finch, Becoming a cyborg: horizons of opportunity in feminist theories and science fictions, p. 9 f.
3: See ibid. p. 59 et seq.
4: See ibid. p. 9 f.
5: Haraway, The encounter of species P. 239.
6: From science.
7: “We are all chimeras, theorized and fabricated hybrids of machine and organism; in short, we are cyborgs” (Haraway, Manifestly Haraway, p. 7; translation by the editor).
Nietzsche and Cyborgs
The International Nietzsche Congress 2025
Under the topic Nietzsche's technologies international visitors were once again invited to the Nietzsche Society conference in Naumburg an der Saale this year. In the period from October 16 to 19, in addition to various lectures, a film screening and a concert, there was also an art exhibition to visit. Our author Emma Schunack was there and reports on her impressions. Her question: How can Nietzsche's technologies find expression in the technological age?
Editorial note: The conference report does not mention the important “Lectio Nietzscheana Naumburgensis,” with which Werner Stegmaier rounded off the conference on Sunday morning and took up the topic of the conference again in a completely different way by asking about Nietzsche's own “philosophizing techniques.” We have now published this important talk in full length with the kind permission of the author (link).
